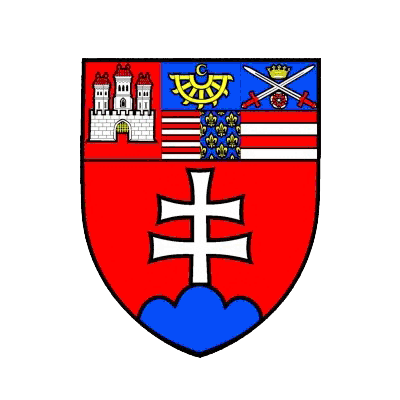Autorin und Übersetzerin Ivana Dobrakovová: Früher hatte ich das Gefühl, dass man immer schreiben sollte
Sie lebt und arbeitet in Turin, übersetzt Werke italienischer und französischer Autoren und ihre eigenen Werke können sich mit Preisen wie dem Literaturpreis der Europäischen Union oder Anasoft Litera rühmen. Im Karpatenblatt-Gespräch verrät sie, wo sich Autorenschaft und Übersetzungsarbeit überschneiden und wie sie sich unterscheiden.
Sie haben Translationswissenschaft in der Kombination Englisch – Französisch studiert, aber später wurde auch Italienisch eine Ihrer Arbeitssprachen. Wie ist Ihr Weg zu dieser Sprache verlaufen?
Darauf gibt es eine einfache Antwort: Während meines Studiums habe ich einen Italiener kennengelernt, der später mein Ehemann wurde und er hat mich zum Italienischen gebracht. Außerdem lebe ich schon seit 2005 in Turin. Ich habe nie an einem Italienischkurs teilgenommen, ich bin also ein hundertprozentiger Selbstlerner. Fremdsprachen zu lernen, hat mir immer Spaß gemacht und ich kann ganz diszipliniert dabei sein. Im Gegensatz zum Französischen hat Italienisch mir nie Widerstand geleistet. Ich denke, dass ich nach diesen 18 Jahren in Italien gut Italienisch spreche, obwohl ich weiß, dass man immer noch spüren kann, dass ich Ausländerin bin. Als Autorin und Übersetzerin arbeite ich jeden Tag mit Slowakisch, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich das Slowakische „verlieren“ könnte, dass ich es ein wenig vergesse, wenn ich es nicht benutze. Es gibt jedoch Dinge, die ich auf Italienisch leichter sagen kann. Und angeblich spreche ich manchmal sogar in meinen Träumen Italienisch.
Ihnen ist es gelungen, Werke von mehreren berühmten Autorinnen wie Elena Ferrante, Silvia Avallone oder Simona Vinci zu übersetzen. Spürt der Übersetzer solcher Werke nicht eine gewisse Verantwortung, ob es gelingen wird, die Werke solch berühmter Autoren in seine Muttersprache zu übertragen?
Übersetzen ist immer mit Verantwortung verbunden – ob es sich um berühmte oder weniger berühmte Namen handelt. Andererseits habe ich das Glück, Autoren übersetzen zu können, die ich respektiere und mag. Ob das Buch auf große Resonanz stößt, ist für mich zweitrangig, allerdings werden Übersetzungen von Bestsellern häufiger zerrissen oder in Frage gestellt. Bei jeder Übersetzung versuche ich, die Autorin oder den Autoren nicht zu „verraten“, das heißt, das Werk nach bestem Wissen und Gewissen zu übersetzen. Ich bin auch ein sehr langsamer Übersetzer, ich übersetze jeden Tag ein bisschen, schreibe viel um, arbeite nicht stoßweise – und natürlich hilft es auch, dass jede meiner Übersetzungen im Verlag noch zwei Augenpaare mehr sehen.
Neben der Übersetzungsarbeit schreiben Sie auch selbst. Mehrere Werke von Ihnen wurden mit wichtigen Literaturpreisen ausgezeichnet. Was hat Sie motiviert, selbst zu schreiben?
Ehrlich gesagt, kam das Schreiben noch vor dem Übersetzen. Ich wusste von Kindheit an, dass ich schreiben möchte, dass ich Schriftstellerin werden möchte. Während meiner Schulzeit habe ich alle möglichen Versuche unternommen, aber erst am Ende des Studiums habe ich angefangen, systematisch zu schreiben. Ich habe hauptsächlich Fremdsprachen studiert, weil ich Sprachen immer gerne gelernt habe, aber nicht mit dem Ziel, Übersetzerin zu werden. An der Universität haben mir literarische Fächer und künstlerisches Übersetzen definitiv mehr Spaß gemacht, als Dolmetschen oder professionelles Übersetzen. Bislang halte ich das Übersetzen für einen schwierigeren Job als das Schreiben. Im fünften Studienjahr bin ich auf einen Text gestoßen, den ich übersetzen wollte. Es ging um einen Text von Marie Darrieussecq und diese lange Geschichte wurde dann in einer Zeitschrift veröffentlicht. Daraufhin habe ich einen Verlag kontaktiert und die Gelegenheit bekommen, das erste Buch zu übersetzen.


Hat sich Ihre Sicht auf die literarische Arbeit und Literatur im Allgemeinen verändert, nachdem Sie selbst Autorin geworden sind?
Früher hatte ich das Gefühl, dass man immer schreiben sollte, dass Schreiben ein Zwang sein muss. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es verloren geht, wenn ich nicht jeden Tag schreibe und ich habe wirklich viel geschrieben – in den ersten Jahren fast zwanghaft, aber die Texte sind gar nicht gelungen. Ich habe auch ständig übers Schreiben nachgedacht und darüber, was ich noch schreiben könnte. Aber in diesen zwanzig Jahren habe ich mich beruhigt und jetzt schreibe ich nicht jeden Tag, ich schreibe nur, wenn ich das Gefühl habe, dass die Idee etwas wert ist, dass daraus ein veröffentlichungsfähiger Text werden kann. Nach und nach bin ich auf längere Genres umgestiegen, Kurzgeschichten fallen mir nur noch selten ein. Von dieser ersten Zeit ist nur noch der Moment des Schreibens übrig geblieben, in dem man in einen Zustand der Ekstase gerät und man spürt, dass man in diesem Moment etwas Grundlegendes, etwas Revolutionäres schreibt.
Ihre Werke werden in mehrere Weltsprachen übersetzt, oft auch in solche, die Sie selbst beherrschen. Lesen Sie Ihre Werke auch übersetzt in Sprachen, die Sie beherrschen? Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
Ich versuche immer, die Übersetzer meiner Bücher zu respektieren und ich muss sagen, dass ich auch sehr glücklich war, hervorragende Übersetzer zu haben, bessere könnte ich mir gar nicht wünschen. Oft möchten sie selbst, dass ich ihre Übersetzung lese und ihnen eventuell Notizen dazu gebe, denn selbst wenn zwei Slowaken denselben Text auf Slowakisch lesen, wird jeder ihn anders lesen und jeder wird ihn anders wahrnehmen. In Wahrheit habe ich mich aber schon mit anderen Übersetzern meiner Bücher gestritten, deren Übersetzungen ich nicht einmal lesen konnte. Ein Übersetzer hat sogar 150 Fußnoten in mein Buch gesetzt und damit, glaube ich, das Buch komplett umgebracht. Außerdem habe ich aufgrund der E-Mail-Kommunikation einmal verstanden, dass die Übersetzerin meines Buches nicht auf derselben Wellenlänge war, weil sie Änderungen vorgeschlagen hat, die für mich nicht akzeptabel waren. Aber das sind eher Ausnahmen, ich kenne die meisten meiner Übersetzer und habe vollstes Vertrauen zu ihnen und mit vielen bin ich inzwischen befreundet.

Sie stammen aus der Slowakei und leben seit mehreren Jahren in Italien. Was fehlt Ihnen am meisten aus der Slowakei?
Ich werde nicht originell sein, aber ich vermisse meine Familie und meine Freunde am meisten. Wenn ich in die Slowakei komme, ist es immer schwierig, dass ich nie alle Leute treffe. In den letzten Jahren komme ich nur noch zweimal im Jahr nach Preßburg/Bratislava. Manchmal vermisse ich einige Orte, zum Beispiel hatte ich während der geschlossenen Grenzen der Covid-Zeit beim Übersetzen Fotos des Horský park (Stadtpark in Bratislava) als Bildschirmhintergrund. Jedes Mal, wenn ich in Bratislava bin, muss ich mindestens einmal durch den Horský park gehen, der der Ort meiner Kindheit ist. In Italien fühle ich mich auch zu Hause, aber manchmal kommt es vor, dass mir jemand das Gefühl gibt, ich sei ein Neuankömmling, dass ich nicht hierher gehöre wie ein gebürtiger Piemonteser. Das passiert mir in der Slowakei nicht. Ich kann sogar zwanzig Jahre weg sein, wenn ich in die Slowakei komme, habe ich das Gefühl, dass die Leute mich als eine von ihnen sehen.
Das Gespräch führte Matej Lanča.
Im Karpatenblatt befasst er sich mit
Literatur, Sprache und Kultur,
die ihm besonders am Herzen liegen