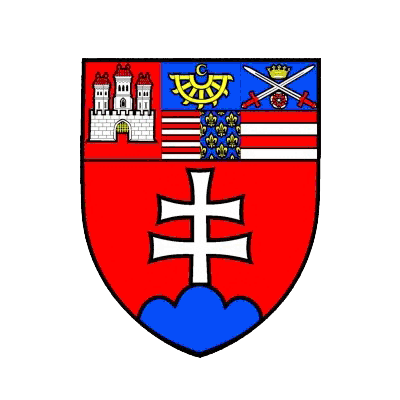„Das Zymbal ist nicht mehr nur ein Folklore-Instrument“
Seit ihrer Kindheit spielt sie Geige und schon mit sieben Jahren wusste sie, dass sie Konzertkünstlerin werden wollte. Das Berufsleben von Enikö Ginzery bestimmte jedoch ein „Möbelstück“, mit dem sie seit Jahren weltweit Solokonzerte gibt. Im Karpatenblatt-Interview erzählt die Musikerin aus der Slowakei über das Zymbal, ihre Konzerterfahrungen und ihr Leben in Deutschland.
Liebe Enikö, wie ist Ihr musikalischer Werdegang verlaufen? Stammen Sie aus einer Preßburger Musikerfamilie?
Ich habe von klein auf Geige gespielt. Angeregt wurde ich dazu von meinen Nachbarn, nicht meinen Eltern. Sie waren Berufsmusiker. Als ich elf Jahre alt war, überredete mich mein Vater, Zymbal zu spielen, weil wir es zu Hause in unserer Wohnung hatten. Mein Großvater hatte damals darauf gespielt. Leider habe ich ihn nie kennengelernt, da er mit 34 Jahren in russischer Gefangenschaft gestorben ist. Das Einzige, was er hinterlassen hat, war das Zymbal, das meine Eltern immer mitgeschleppt haben. Ich habe es als Möbelstück betrachtet und hatte keine Beziehung dazu. Ich wollte es nicht spielen, da ich dachte, dass es ein Instrument nur für Volksmusik sei, und ich war damals schon auf Klassik eingestellt. Fünfundneunzig Prozent der Zymbalspieler, die ich kenne, kommen aus einer Familie, in der die Zymbalmusik mit der slowakischen, der ungarischen oder der Roma-Volksmusik verbunden ist.
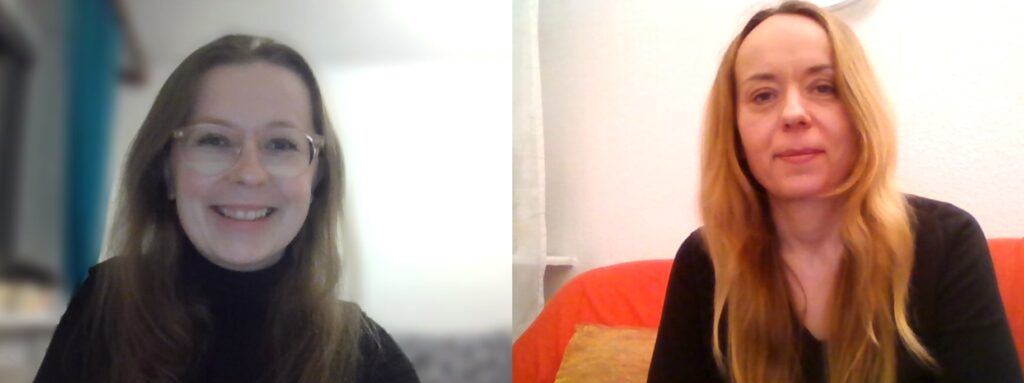
Ihre erste Lehrerin war Frau Beate Čečková. Wie erinnern Sie sich an Ihren ersten Zymbalunterricht?
Die Begegnung mit ihr war eine wirklich angenehme Erfahrung. Wenn ich mich an den Geigenunterricht erinnere – das war ein Technikterror, wir haben vor allem geübt, den Bogen zu halten und technische Probleme gelöst. Als ich zu meiner ersten Zymbalstunde gekommen bin, konnte ich sofort improvisieren, ohne zu wissen, wo die Saiten sind oder wie sie heißen. Das eröffnete mir einen neuen Horizont in der Musik. Das war der erste Anstoß für mich, das Zymbal zu mögen.
In der Slowakei müssen sich Schüler schon sehr früh entscheiden, ob sie einen musikalischen Beruf ergreifen wollen. Für Sie war es aber offensichtlich, oder?
Als ich sieben Jahre alt war, wusste ich, dass ich Konzertmusikerin werden wollte. Mit 14 habe ich mich dann entschieden, an das Konservatorium in Preßburg/Bratislava zu gehen und Zymbal zu spielen. Das war eine bahnbrechende Arbeit, es war etwas völlig Neues – bis heute ist das auch in Westeuropa so. Eigentlich war es meine Professorin, die mich zum Zymbal ermutigt hat, in dem sie sagte: „Es gibt eine Million Leute, die Geige spielen, und es gibt viel Konkurrenz.“ Aber damals war das Spielen von klassischer Musik auf dem Zymbal in der Slowakei eine ziemliche Seltenheit. Abgesehen von meiner Professorin am Konservatorium Ľudmila Dadáková hat niemand klassische Konzertmusik auf dem Zymbal gespielt. Ihr Mann hat auch Musik für sie komponiert – damit war mein Interesse an zeitgenössischer Zymbalmusik im Allgemeinen geweckt.
Ja, in der Slowakei muss man sich schon sehr früh entscheiden, ob man Musiker werden will. In Deutschland entscheidet sich ein Schüler erst mit 18 Jahren, ob er an eine Musikakademie gehen will. Zugegebenermaßen ist das in unserem Land etwas unglücklich, denn die Schüler sind zu 90 Prozent auf die Musik konzentriert und verpassen in der Regel Fächer wie Geschichte oder Mathematik. Da muss er oder sie schon sehr viel lernen, sonst bleibt er oder sie einfach dumm. Es ist dann schwer, etwas anderes zu studieren.

Nach dem Konservatorium haben Sie Zymbal an der Liszt-Akademie in Budapest studiert. Danach hat es Sie aber zum Studium der zeitgenössischen Musik nach Saarbrücken verschlagen. Wie erinnern Sie sich an Ihre Anfänge in Deutschland?
Als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich kein einziges Wort Deutsch. Obwohl meine Ururgroßeltern aus Heidelberg stammten, haben wir zu Hause nicht Deutsch gesprochen. Soweit ich weiß, zog meine Urgroßfamilie im 14. Jahrhundert in die Mittelslowakei. Ginzer wird sogar heute noch als Nachname in der Gegend verwendet. Das Y kam zur Zeit der Magyarisierung dazu, damals wurde es an fast jeden Nachnamen angehängt.
Im ersten Jahr an der Hochschule für Musik Saar im Studiengang Zeitgenössische Musik habe ich Englisch gesprochen, aber nach und nach war ich gezwungen, auch wegen der Prüfungen Deutsch zu lernen. Ich gebe zu, dass ich erst richtig Deutsch zu sprechen begonnen habe, als ich die Grammatik verstanden hatte, was etwa sieben Jahre später der Fall war. Es war eine unangenehme Zeit und ich habe mich oft geschämt, wenn ich meine eigenen Konzerte nicht richtig abmoderieren konnte.

Die Kombination von zeitgenössischer Musik und Zymbal ist auch heute noch eine Seltenheit. Wie war Ihr Studium in Saarbrücken?
Als ich gehört habe, dass man in Deutschland Interpretation von zeitgenössischer Musik studieren kann, habe ich keine Minute gezögert. Es war das beste Studium meines Lebens! Auch wenn ich die einzige Zymbalspielerin in der Abteilung war, die der Rektor übrigens eigens für mich öffnen musste, konnte man sich viele Techniken der Aufführungskunst zeitgenössischer Musik vom Klavier abschauen. Denn das Zymbal ist der direkte Vorfahre des Klaviers – ohne Zymbal gäbe es kein Klavier. Die Gemeinsamkeiten dieser Instrumente liegen in der Schlagmechanik. Seine Entwicklung fand im 18. Jahrhundert in Dresden statt. Das Zymbal beziehungsweise sein Vorgänger das Hackbrett war damals ein sehr gefragtes Instrument – es war sogar Teil der königlichen Kapelle. Mit der Erfindung des Klaviers starb das historische Hackbrett – das Pantaleon – aus, da das Hammerklavier (Fortepiano) mit zehn Fingern leichter zu bedienen war als mit zwei Schlegeln. Das Hackbrett wurde aus der klassischen Szene verdrängt und überlebte nur in der traditionellen Musik – besonders in Bayern. Man kann sagen, dass das Zymbal als vollwertiges Konzertinstrument seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Komponisten wie Strawinsky, Pierre Boulez, Stockhausen oder Kurtág eine Renaissance erlebt.
Viele zeitgenössische Komponisten haben speziell für Sie komponiert, zum Beispiel Theo Brandmüller, Hans J. Hespos, Rainer Rubbert und Gabriel Irany aus Deutschland oder die slowakischen Komponisten Juraj Beneš, Vladimír Bokes, Peter Machajdík und Juraj Hatrík. Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihren Konzerten gemacht, wie wird die zeitgenössische klassische Musik wahrgenommen?
Das hängt davon ab, in welchem Konzert man ist. Wenn man ein Konzert mit zeitgenössischer Musik ausgewählt hat, weiß der Zuhörer wahrscheinlich, worauf er sich einstellen muss und dann ist diese Reaktion auch in Ordnung. Aber wenn man zum Beispiel ein Konzert in der Philharmonie besucht, muss man gut darin sein, zeitgenössische Musik in die Dramaturgie einzubinden. Ich habe das Gefühl, dass in der Slowakei das Publikum unterschätzt wird. Ich habe schon mehrmals die Meinung gehört, dass man keine zeitgenössische Musik spielen sollte, da die Leute sie nicht hören wollen. Ja, wenn wir das Publikum nicht erziehen, wird es so sein. Auch in der Berliner Philharmonie oder in Wien gibt es immer mindestens eine Uraufführung zeitgenössischer Musik neben den Großen wie Mozart oder Schumann. So lernt das Publikum, dass auch diese Musik zu uns gehört, dass sie unsere Sprache der Zeit ist. In der Slowakei wird leider noch sehr wenig zeitgenössische Musik gespielt.
Wo treten Sie gerne auf?
Ich spiele am liebsten dort, wo ich das Gefühl habe, dass die Menschen die Musik mit offenem Herzen annehmen. Meine Energie wächst dann und ruft schon während des Konzerts in jedem Moment etwas Besonderes hervor, was sich auch im Spiel widerspiegelt.
Sie leben derzeit in Berlin. Was gefällt Ihnen hier am besten, vielleicht sogar im Vergleich zur Slowakei?
Die Diversität, Multikulturalität und Offenheit. Insgesamt gefällt mir in Deutschland das äußerst vielfältige kulturelle Leben und seine Möglichkeiten. Hier hat selbst das kleinste Dorf sein eigenes kulturelles Leben und zwar auf einem guten Niveau. In der Slowakei konzentriert sich die Kultur in den Städten. In den Dörfern gibt es oft nichts, was ich sehr schade finde. Wir sind eine homogene Kultur, mit wenig Einfluss und Inspiration aus anderen Kulturen, was allerdings nicht immer der Fall war. Das beweisen zum Beispiel verschiedene Musiksammlungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, aber auch andere Kunstrichtungen aus diesen, man könnte sagen, multikulturellen Zeiten auf unserem Gebiet. Dann kam die Totalität, die alles zubetonierte. Teilweise gibt es noch Scherben, einen Hauch von Postsozialismus.
Was den Alltag betrifft, ist es hier möglich, mit Qualität zu einem erschwinglichen Preis zu leben. Und ich mag auch das viele Grün in Berlin, die vielen Parks – einer schöner als der andere.
Wo hatten Sie beim Spielen die schönsten Erlebnisse?
In der Slowakei. Die Leute haben offene Herzen und es ist einfach ein außergewöhnliches Gefühl, wenn meine Eltern und meine Freunde aus der Kindheit im Publikum sitzen.
Wir von der Karpatenblatt-Redaktion wünschen Ihnen alles Gute und viel Energie für Ihre weiteren Konzerte!
Das Gespräch führte Ľudmila Glembová.
Hier können Sie eine Kostprobe von Enikö Ginzerys Zymbal-Musik hören:
Das nächste Mal kann man die Zymbal-Virtuosin Enikö Ginzery hier hören:
– April 2022: Orpheus, Claudio Monteverdi, Komische Oper Berlin (Zymbal als Hauptinstrument Basso continuo)
– Konzerte „Hommage a Pantaleon Hebenstreit“ im Rahmen des GVL-Kreativstipendiums: Berlin, Saarbrücken, mit Zymbal solo, Zymbal-Orgel, Zymbal-Klavier
– Konzert: J.S. Bach: „Sei gegrüßet“ für Chor, Zymbal, Orgel, Klavier (Berlin)
– Uraufführungen: Rene Staar (Wien), Rainer Rubbert (Berlin), Norbert Fröhlich (Berlin), Mate Hollos (Budapest)