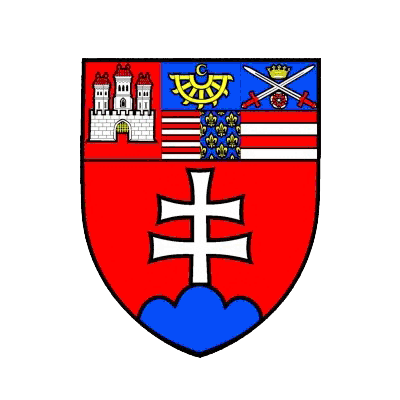Weihnachtliches Brauchtum in Göllnitz
Sollten wir nicht mal innehalten und an das „einfache, bescheidene und doch so reiche Weihnachtsfest“ denken, das Karpatendeutsche früher in der Tiefe ihres Herzens erlebt haben? Dafür steht die folgende Erinnerung an das weihnachtliche Brauchtum in Göllnitz, die wir Geza Roth verdanken.
Diese Geschichte erscheint 2020 im neuen Band der Zipser Trilogie „Unterzipser erzählen. Mantaken dazähln“, der im Verlag ViViT Kesmark herauskommt. Klicken Sie hier und hören Sie, wie Weihnachten einst in Göllnitz aussah:
Wenn ein Jahr sich wieder seinem Ende nähert, wenn gar Schneeflocken zur Erde fallen, dann gehen die Gedanken eines Zipsers in seine verlorene Heimat zurück. Sehr lebendig sind noch die Erinnerungen an die vergangene Jugendzeit, an die überlieferten Bräuche und Sitten um das Weihnachtsfest.
In den allermeisten Häusern gab es einen eigenen Backofen. So konnte jeder seine Weihnachtsvorbereitungen so planen, wie es ihm am besten passte. Es wurden die Unterzipser Spezialitäten gebacken: „Krautpeltschn“, Reispeltschn“, „Prinzentrotschka“, „Nuss- und Mohnmugln“. Vorausgegangen war schon tagelang die Plätzchenbäckerei. Wir Kinder durften mithelfen, Nüsse mahlen, Teig rühren, die Formen ausstechen, die Teigfiguren mit Marmelade oder Schokolade bestreichen.
Die schönsten an den Baum
Einige besonders schöne Stücke wurden mit einer Nadel durchstochen, mit einem Zwirnfaden versehen und dann auf den Christbaum gehängt. Natürlich gab es manchen – oft absichtlich herbeigeführten – Bruch bei dieser Arbeit; das Ergebnis wurde sofort verspeist. Recht ungewöhnlichen Streit gab es nicht selten um die Folge, wer welche Schüssel ausschlecken durfte. Tagelang duftete es im Haus bis auf die Straße und zur Nachbarschaft.
Der Vater hatte Beziehungen zum Förster und durfte sich vom „Halnal“ (Hügelchen) selbst einen schönen Tannenbaum absägen. Tannenwälder gab es ja bei uns genug. Freilich, kostenlos war der Baum nicht, Vater hatte dem Förster im Wirtshaus schon vorher gar manchen Schnaps bezahlt.
Rechtzeitig schon kaufte Mutter „Fondant-Zuckerwürfel“ ein, dazu silbernes und goldenes Staniolpapier. Nun wurden die Würfel einzeln verpackt und mit Zwirn zum Aufhängen auf dem Weihnachtsbaum vorbereitet. Das überstehende weiße Papier wurde mit der Schere fein eingeschnitten, so dass gleichmäßig Fransen entstanden. Das so entstandene Werk hieß dann „Salonzucker“. Er sah kostbar und festlich aus.
In späteren Jahren konnte man den Salonzucker gleich schachtelweise kaufen, dazu Schokoladenfiguren in buntem Stanniol und auch Christbaumbehang aus Glas. Aber ihn zu Hause machen, das war billiger und auch interessanter. Walnüsse wurden mit Holzstiften, den sogenannten „Schusterkeilchen“, genagelt, dann mit Gold- oder Silberbronze bemalt und ebenfalls auf den Baum gehängt.
So war Weihnachten früher da, als man dachte
Am Heiligen Abend gingen wir gemeinsam in die Kirche, dann aber schnellstens nach Hause. Zum Abendessen gab es Schweinsbratwürstchen aus eigener Schlachtung, Kartoffeln und Kraut aus eigenem Fass. Wir hatten eine eigene Kuh, die vom städtischen Hirten über die Sommermonate auf der Weide (Trohanken) gehalten wurde. Dafür mussten wir eine Gebühr an die Stadt bezahlen. Wir freuten uns immer, wenn wir die „Fanny“ auf der Weide besuchen und ihr etwas Gutes bringen durften. Am Heiligen Abend kam der Hirte zu seiner „Kundschaft“ und blies mit seiner Trompete ein Weihnachtslied vor dem Haus. Natürlich wurde er dafür reich beschenkt.
Vater hatte schon vor Jahren eine Krippe und ein Kirchlein gebastelt; sie wurde jeder Jahr hervorgeholt und auf Hochglanz gebracht. Dann wurde ein brennendes Kerzlein draufgesetzt, und wir – mein Bruder und ich – gingen zu den Nachbarn und zur großen Verwandtschaft, um „frohe Weihnachten“ zu wünschen. Vor den Fenstern sangen wir „O Tannenbaum“ oder „Laufet ihr Hirten“.
Manchmal ging auch Vater mit seiner Ziehharmonika mit, dann klang es noch besser. Unser knappes Taschengeld wurde durch diese Aktion wesentlich aufgebessert. Freilich, es war mühsam verdient. Wie oft mussten wir die Kerzen bei dem Wind neu entzünden und unsere Finger froren bei der großen Kälte. Die Winter waren sehr streng. 30 Grad Frost waren keine Seltenheit. Die Schindeldächer „prasselten“, wenn die rostigen Nägel bei dieser Kälte die Spannung nicht aushielten.
Sternsinger zogen durch die Gemeinde
Vor der evangelischen Kirche war eine Art „Sternsinger Gruppe“ aus vier Buben gebildet worden. Sie sang in den evangelischen Häusern, sammelten Geld und lieferten es beim Herrn Pfarrer ab. Einen Teil davon bekamen die Sänger als „Prämie“. Ich wollte auch einmal mitgehen, da ich ja im Singen eine Eins hatte. Zuerst hieß es, ich sei noch zu klein. Später erfuhr ich, dass es einen anderen Grund gab. Mein Vater war nämlich bei der Eisenbahn beschäftigt, und die Sänger sollten aus ärmeren Familien kommen.
Ja, es gab bei uns schon damals eine „soziale Marktwirtschaft“! All dies liegt schon viele Jahrzehnte zurück. Doch heute noch denke ich mit Rührung an das einfache, bescheidene und doch so reiche Weihnachtsfest meiner Kindheit.
Prof. Dr. Ferdinand Klein
Aus Band 2 der ZIPSER TRILOGIE „Unterzipser erzählen. Mantaken dazähln“ (erscheint 2020 im Verlag ViViT Kesmark)