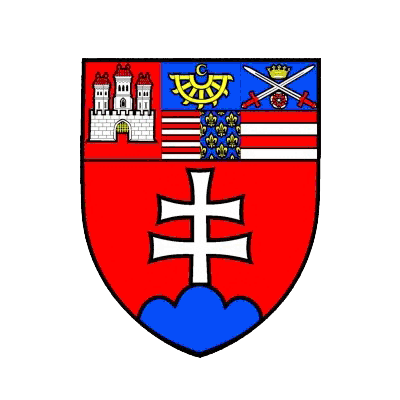Unsere Flucht aus Oberschlesien
Heinz H. Bathelt wurde 1938 im oberschlesischen Bielitz geboren. Hier erzählt er, wie er das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte sowie was er und seine Familie in den Tagen danach erlebten.
Die letzten Weihnachten in der alten Heimat waren schon sehr deprimierend. Alle männlichen Familienmitglieder fehlten, auch die üblichen Geschenke. In den letzten Monaten des Jahres 1944 versiegte auch die Post von meinem Vater. Er schrieb immer nur „im Westen“. Gut drei Wochen später begann unsere Ausreise mit den vielen Zwischenstationen. Auch das war mit Hindernissen verbunden: Meine Mutter bekam zur Evakuierung ihrer Kinder drei Tage mit der Verpflichtung, dann wieder im Büro anzutreten. Meine Großmutter war auch ganz allein und durfte nicht mit, weil sie erst 58 Jahre alt war. Alle drei Söhne waren im Krieg, so wie ihr Mann, der mit 60 Jahren erneut zur Marine eingezogen wurde, obwohl er im Ersten Weltkrieg verwundet worden war. Sie musste zurückbleiben und erlebte die Eroberung durch die Rote Armee. Sie kam aber gut durch diese schlimme Zeit, kochte für die Russen und war somit versorgt.
Die Geburtstage von Mutter und Großmutter Mitte Jänner wurden noch bei uns gefeiert. Eine Woche später war dann die Abreise nach Jägerndorf im Sudetenland. Dort lebten mehrere Verwandte meiner Großmutter, wo wir unterkommen konnten. Zu dieser Zeit standen die Russen vor Auschwitz, etwa 50 Kilometer entfernt, wir hörten den Geschützdonner.
Mittags zogen wir in die Innenstadt, die auf einer Anhöhe lag, um eine warme Mahlzeit einzunehmen. Ich habe diese Tage in schöner Erinnerung, es war wie im Frieden. Auf einmal war alles mäuschenstill geworden, fast unheimlich war die allgemeine Waffenruhe am 8. Mai 1945. Es war wie im Niemandsland; alle sonstigen Einrichtungen funktionierten wie bisher, das Versorgungsgeld wurde weiterhin bar ausbezahlt. Aber bei uns tat sich die große Frage auf: Was tun? Und wohin?
Meine Großmutter hatte als junge Mutter im Frühjahr 1915 das Herannahen der russischen Front erlebt. Damals wurde Geschirr und Wäsche in Körbe verpackt und nach Wien verfrachtet. Erst als General Falkenhayn mit deutscher Verstärkung die Front wieder gefestigt hatte, war die Gefahr gebannt. Und so wurde die Lage im Mai 1945 eingeschätzt, es hieß, es beruhigt sich wieder und man könnte doch wieder zurück nach Bielitz.
Dazu waren einige Maßnahmen und Verhaltensregeln für uns Kinder erforderlich. Zuerst wurde festgelegt, dass wir alle vier polnische Rückkehrer seien; dazu wurden Kokarden in Rot-Weiß an unsere Kleidung angenäht und uns Kindern strikt verboten, ein deutsches Wort auszusprechen. Außerdem wurden von Mutter und Großmutter verschiedene „Verpackungen“ angefertigt, in Bargeld in Strumpfgürtel und Mieder eingenäht, Wollpullover aufgetrennt und um Schmuck und Uhren gewickelt.

Nach diesen Vorbereitungen fuhren wir per Bahn in Richtung Bielitz. An einem der nächsten Umsteigebahnhöfe (wahrscheinlich Oderberg) mussten wir viele Stunden auf dem Bahnhofsgelände warten. Und das war unser Pech! Wir wurden von Miliz in einen Vorraum gelotst, dort begann die erste Filzaktion. Alle Koffer wurden ausgeräumt und vieles vom Inhalt auf den nächsten Aktenschrank geworfen, vor allem die Wollknäuel mit dem eingewickelten Schmuck. Alle neuwertigen Wäschestücke fielen dem Raub zum Opfer. Nur meine Schultasche auf dem Rücken rührte keiner an. Endlich ließ man von uns ab und wir konnten die Fahrt nach Bielitz fortsetzen. Am Bahnhof angekommen, reagierte meine Mutter schlau, denn am Ausgang standen einige Milizionäre mit Wäschestricken über der Schulter. Aber am Eingang saß in einem Glashäuschen ein uniformierter Bahnbeamter. Er antwortete auf die polnisch gestellte Frage meiner Mutter, ob wir mit dem vielen Gepäck „ausnahmsweise“ herausgehen durften, „Aber ja!“ Auf diese Weise entkamen wir dem Lagerleben, das alle Bielitzer Rückkehrer erwartete.
Dann begann unsere „illegale Zeit“ in der Heimatstadt, das hieß keine behördliche Anmeldung, keine Adresse, keine finanziellen Zuwendung usw.
Wir deponierten die Koffer und zogen zu Fuß los, unsere Verwandten und Wohnungen aufzusuchen. Unsere Wohnung auf der Schießhausstraße war von fremden Leuten besetzt, doch ich hörte aus den offenen Fenstern unsere Dreiklanguhr aus dem Speisezimmer. Aber den Mut hineinzugehen hatten wir nicht. Eigentlich ging meine Kinderzeit in diesen Tagen zu Ende –in der Familie war „Mann“gefordert.
Ich weiß bis heute nicht genau, wo meine Mutter und wir Kinder unser müdes Haupt in diesen Tagen in Bielitz hinlegten. Unsere Oma fanden wir im selben Haus, aber in einer anderen Wohnung – als Untermieterin bei einer polnischen Familie, aber sonst war sie gesund und munter. Auch die vielen Gerüchte über geheime Folterlager, in denen Bielitzer festgehalten seien, verunsicherten uns alle sehr.
Nun fasste meine Mutter die Ausreise nach Österreich ins Auge. Dort stand in der Nähe von Linz ein Haus, das unserer Familie gehörte. Dieses Reiseziel wurde mit meinem Vater als Treffpunkt vereinbart, wenn alles daneben gehen sollte. Aber das war nicht so einfach; es gab keine Zugverbindung nach Wien. Irgendwie ergatterte die Mutter Karten für uns fünf (auch die zweite Oma war mit von der Partie) und wir konnten zum nächsten Bahnknotenpunkt Oderberg fahren. Aber bis dahin mussten wir eine neue Durchfilzung durchmachen: Alle neuen, sauberen Sachen flogen heraus, nur die schmutzigen blieben im Koffer. Meine Schultasche auf meinem Rücken griff wieder keiner an.
Anlässlich eines Zwischenhaltes an einem kleinen Bahnhof haben wir Ausschau nach Getränken gehalten. Da sahen wir einen Ziehbrunnen und davor mehrerer Rotarmisten in ausgelassener Stimmung. Es waren noch die ersten Kampftruppen – Mongolen aus Sibirien, die lange dünne Schnurrbärte trugen. Über die Schultern trugen sie schöne Frotteehandtücher, mehrere Armbanduhren an den Handgelenken. Der Ort bestand nur aus einem riesigen Bahnhof mit unzähligen Gleisen. Es war am selben Tag kein Weiterkommen, also begann die Suche nach einem Quartier.
Wir kamen an ein Wohngebäude am Rande, bewohnt von einem älteren Schneider. Er war von gütigem Gemüt und hatte Mitleid mit uns Illegalen. Er räumte uns einen Schlafraum ein, wo wir gut unterkamen. Aber dann am Abend ging es los! Seine Frau kam nach Hause und es begann ein lauter Disput in einer uns nicht verständlichen Sprache (Tschechisch), aber der Schneider beruhigte uns, es werde uns nichts geschehen. Ein Schrank wurde vor die Zimmertür geschoben und ich hielt Wache am verhängten Fenster. Als es dann dunkel wurde, kamen grölende Männer mit Flaschen und Holzknüppeln an, die sichtlich betrunken waren – mit der eindeutigen Absicht, die „Niemce“ auszulöschen. Ich spürte, dass es ernst war, aber der Mann blieb fest. Sie zogen dann wieder ab, nachdem sie noch etwas „zum Nachspülen“ erhalten hatten. Am nächsten Morgen, als wir uns bei dem Mann für unsere Lebensrettung bedanken wollten, winkte er nur ab, das wäre allein seine eigene Sache gewesen.
Mit dem „Währungsmischmasch“, der zu dieser Zeit herrschte, war der Kauf von Lebensmitteln schwierig, meist nur geschenktes oder aufgelesenes Obst; es war ja Juni/Juli. Brot haben wir meistens erbettelt, und selten wurde dies von Bauersfrauen verweigert, sie waren auch alle fromm und katholisch. Eine große Schnitte von einem großen Laib musste dann für uns alle einen ganzen Tag lang reichen. Als der Güterzug mit den offenen Planwagen ziemlich auf der Strecke stehen blieb, scheuten wir uns nicht, von den Feldern Gurken zum Durstlöschen zu holen.
Nun hieß es: schnell weiterkommen. Meine Mutter, als am besten sprachbegabt, traf einen Eisenbahner, der ihr von einem Güterzug erzählte, der nach Pressburg und damit in die Nähe von Wien fahren sollte. Wir fanden mit Hilfe des Bahnbeamten einen weitab stehenden Güterzug, der einige leere Plattenwagen enthielt. Wir erklommen einen solchen und stapelten unsere Koffer und Rucksäcke in die Mitte der Ladefläche und kauerten uns wie die Glucken herum. Der Zug fuhr er sehr, sehr langsam und blieb oftmals stehen. Und endlich kurz vor Pressburg; die Strecke war blockiert. Nach kurzem Ruck ging es ein Stück zurück und dann über die nahe March nach Österreich (ohne Grenzkontrollen – die Russen guckten nur zu).
Was für ein Aufatmen war zu verspüren, als wir die Station „Gänserndorf“ lesen konnten. Der Zug fuhr ohne Zwischenhalt bis zum Floridsdorfer Bahnhof-Wien, 21. Dort war erst einmal Endstation und alle mussten den Zug verlassen. Mutter und ich wurden mit leichtem Gepäck vorausgeschickt, um den weiteren Weg zu erkunden. Wir wollten zum Bruder meiner Mutter in den 14. Bezirk. Dazu musste man die Donau überqueren, aber die Floridsdorfer Brücke war gesprengt.
Die Straßenbahn ging bis zur Donaubrücke, dann begann das Abenteuer. Am Ufer stand schon eine lange Menschenschlange mit viel Hamsterware aus dem Umland. Die Stahlbögen der kaputten Brücke waren mit Holzlatten umzäunt und als Fußsteig eingerichtet. Es ging sehr langsam vor sich; mir kam es endlos vor. Als wir fast am stadtseitigen Ufer angekommen waren, ging überhaupt nichts mehr. Trotz der Sommerhitze erhob sich ein heftiger Sturm, eine Art Wirbelsturm, der sehr viel Flugsand enthielt. Alle Passanten in unserem Umkreis drehten sich mit dem Rücken zum Wind und schlossen fest die Augen.

Eine Frau in unserer Nähe hatte sich ziemlich mühsam mit einem flachen Korb voller Marillen durchgekämpft. Als der Winddruck wieder nachließ und alle ihre Augen aufschlugen, da war der Korb völlig leer. Keiner wusste, wie das geschehen konnte – entweder war es der Sturm oder alle Marillen gestohlen. Die Frau jedenfalls war verzweifelt.
Mutter und ich zogen aber weiter unserem Ziel entgegen; zum Teil mit der Stadtbahn, aber auch zu Fuß über Schuttberge. Und der Onkel empfing uns mit den Worten: „Ich habe Euch schon erwartet.“ Er übergab uns die Schlüssel für unser Haus. Ob es stand oder bombardiert war, konnte niemand sagen, zumal es in der russischen Zone lag und wir alle keine Papiere hatten.
Heinz H. Bathelt
(Fotos: Heinz Bathelt privat)