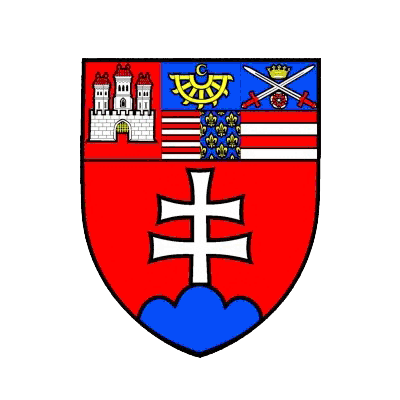Das Gären und Gebären im Schoße der Corona-Epoche
Das Verhältnis unseres Volkes zu dieser geschichtlichen Pandemie ist in seinem zweiten Jahr ein anderes als in seinem ersten. Was wir alle bei ihrem Ausbruch erst ahnten, das sehen und wissen wir heute genau. Aus einem lokal bedingten Ereignis wurde ein weltweites geschichtliches Ringen. Erst der Einzug der zweiten und deutlich sich anbahnenden dritten Welle hat uns die Augen geöffnet für die tiefere Problematik.
Wir befinden uns alle gemeinsam auf einem Schiff, das sich durch die sturmgepeitschten Corona-Wellen hindurcharbeitet. Wir hören auf das Kommando des Kapitäns und tun jeder an seinem Platze seine Pflicht – nach dem besten Wissen und Gewissen, immer in dem Bestreben, mit dazu beizutragen, dass wir durch den Orkan der Ereignisse hindurch den sicheren Hafen eines glücklichen Friedens ansteuern. Wer sich aus der kämpfenden Gemeinschaft heraus begibt, läuft Gefahr, über Bord gespült zu werden.
Viren machen weder Urlaub noch Umwege
Nicht nur Tugenden, sondern auch Untugenden sind ansteckend, manchmal mehr als das Virus mit seinen Mutationen selbst. Auf keinen Fall darf es so weit kommen, dass der, der treu und brav seine Pflicht erkennt und erfüllt, am guten Schluss für dumm angesehen wird, und der, der sich daran vorbeizudrücken versteht, als Ausbund der Schlauheit gilt. Es ist natürlich angenehmer, bequem zu leben und die Corona-Pandemie aus der Entfernung zu betrachten. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, vor den Pflichten der Pandemie zu fliehen, dann ließe sich darüber reden. Aber die gibt es nicht und darum ist daraus die Folgerung zu ziehen: Da alle einmal in den Genuss von süßen Siegesfrüchten kommen, haben alle auch dem Zwang dieses Pandemiekrieges zu gehorchen. Viren kennen ja auch keine Ausnahmen und Pause machen sie ja auch nie.
Selbstausgrenzung der „Unbeteiligten“
Nichts kann uns von der Erfüllung unser Pflichten, bei der die selbstauferlegte Impfpflicht die oberste Stelle einnimmt, entbinden. Ob der Patient uns das einmal danken wird, hängt davon ab, ob es uns gelingt, ihn am Leben zu erhalten.
Wir wissen, dass unser Land auch bei klügster und weitsichtigster Führung nur in einem gesunden europäischen Kontinent leben und gedeihen kann. So sehr wir von dem Bewusstsein durchdrungen sind, dass Europa auch ohne uns nicht zu existieren vermag, so genau sind wir uns zugleich klar darüber, dass wir ohne Europa nicht auskommen können. Wir sehen über den Krisen und Belastungen der Gegenwart, die vor allem durch diese krisenbeladene Coronazeit bedingt sind, die Vision einer neuen, sinnvollen gemeinsamen europäischen Ordnung emporsteigen. Ordnung ist immer die letzte Folge der Verwirrung.
Wenn Europa den höchsten Stand seiner Fieberkrise erreicht hat, ist es reif zur Gesundung. Die Schauer seines hektischen Zustandes sind keine Symptome des nahenden Todes, sondern Symptome des kommenden Lebens. Nur sehr selten hat der Kranke Verständnis für das, was der Arzt ihm rät und verordnet. Erst später wird er sich klar darüber, in welcher Gefahr er schwebte. Ohne Rücksicht auf seine momentanen Unbesonnenheiten aber ist es die Pflicht des Arztes, alles das einzuleiten und anzuwenden, was ihm seine Kunst an Hilfsmitteln für den Gesundungsprozess anbietet und wenn nötig auch eine Radikalkur nicht zu scheuen, wenn anders der Patient nicht mehr zu retten ist.
Siegmund Freud tröstete einmal Erich Maria Rilke, indem er ihm ans Herz legte, dass seine Welt einem alten Baum gleiche, der sich in der Fäulnis und ohne jedwede Sichtweite befinde. Um diese wieder zu gewinnen, bedürfe es, diesen Baum fällen zu lassen, da er doch zugleich Früchte trage und diese wieder Kerne als Samen und Keime neuen Lebens beinhalten.
Und in einer solchen Lage sind wir nun alle – alle, wo immer wir auch leben. Jeder trägt seinen Samen einer neuen besseren Zeit in sich, wobei jeder zugleich seinen Boden zu roden und zu pflügen hat, damit der gesäte Samen zu einem neuen Baum mit kostbaren Früchten emporwachsen kann. Eine neue Epoche bricht trotz allen schmerzlichen Ballasten und Begleiterscheinungen an. Friedrich Schiller schreibt in seinem „Taucher“ Folgendes, so Aufschlussreiches in ursprünglicher und so herrlich musikalisch klingender Fassung:
Laß ich los der Koralle umklammerten Zweig,
Gleich faßt mich der Strudel mit rasendem Toben,
Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach oben.
(…)
Und es wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel sprützet der dampfende Gischt,
Und Flut auf Flut sich ohne Ende drängt,
Und will sich nimmer erschöpfen und leeren,
Als wollte das Meer noch ein Meer gebähren.
(…)
Und wie er tritt an des Felsen Hang,
Und blickt in den Schlund hinab,
Die Wasser, die sie hinunter schlang,
Die Charybde jetzt brüllend wiedergab,
Und wie mit des fernen Donners Getose
Entstürzen sie schäumend dem finstern Schoose.
Und wir schließen mit dem Zeitgeist gebührenden Worten: Es gärt und gebärt hier und heute eine neue schillernde Nachcoronawelt. Gerade im finstern Schoße unserer trüben von Corona so stark gezeichneten Epoche.
Oswald Lipták
Möge die Tonaufnahme von Schillers „Taucher“ von Franz Schubert jedem von uns beim Lesen dieser Zeilen sowohl als schöner musikalischer Hintergrund, als auch als Quell steter Freude und innerer Kraft dienen: