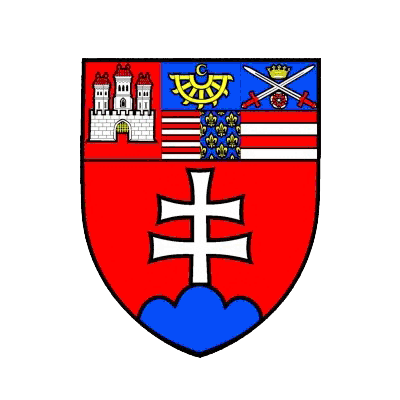Erinnerungen an die Weihnachtszeit in Glaserhau
Das schönste Fest des Jahres war ohne Zweifel Weihnachten. Über Wiesen und Feldern lag schon einige Wochen vorher eine dicke, weiße Schneedecke. Jeder Zaunpfahl hatte eine weiße Mütze auf und die Sträucher sahen aus, als ob sie mit feinem Zucker bestäubt worden wären.
Sobald am Nachmittag die Schulaufgaben erledigt und die zugeteilten Arbeiten getan waren, wurde der Schlitten aus dem Schuppen geholt – und hinaus ging´s in die herrliche Winterpracht. Erst wenn die Hände klamm und die Füße steif vor Kälte waren, gingen wir wieder nach Hause. Anschließend saßen wir eine Weile im Dämmerschein auf der warmen Ofenbank, schlossen die Augen und träumten von Weihnachten, dem Heiligen Abend und dem Christkind.
Viel zu tun an Heiligabend
Am Heilig-Abend-Tag gab es bei uns besonders viel zu tun. Damit das Hefegebäck für die Feiertage frisch war, wurden die flachen Mohn- und Quarkkuchen, „Peltsch´n“ genannt, erst am Vormittag des Heiligen Abends gebacken. Dazu musste der große Backofen beheizt werden – das gab sehr viel Arbeit. Natürlich packten da alle zur Verfügung stehenden Kräfte fest an. Wir Mädchen gingen der Mutter an die Hand, die Buben halfen im Stall, füllten die Holzkisten und holten Wasser vom Brunnen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit war alles geschafft.
In der guten Stube stand der Christbaum, geschmückt mit bunten Glaskugeln, selbstgemachten Papierblumen und Kerzen. Unter dem großen Tisch stand das große Getreidesieb, gefüllt mit den Früchten des Feldes, einem Laib Brot, geweihten Kräutern und Salz. Es durfte nichts vergessen werden, damit es im nächsten Jahr an nichts fehlte. Zum anschließenden Abendessen versammelten sich die Familienmitglieder in der guten Stube, in der noch kein Licht brennen durfte. Festlich bekleidet saßen alle am Tisch, außer der Mutter. Von der Küche her war die Stube nur spärlich erleuchtet. Im Ofen knisterte es geheimnisvoll, und durch die Luftritzen der Ofentür tanzte der helle Schein des Feuers auf dem Fußboden unruhig hin und her.
Feierliche Stille herrschte im Raum, wir Kinder saßen da mit großen Augen und laut pochendem Herzen – Augenblicke, die man ein ganzes Leben lang nicht vergisst.
Der Christbaum erleuchtete
Endlich kam die Mutter mit einer brennenden Kerze – dem Symbol des Lichts – in die Stube und grüßte die Familie mit dem Weihnachtsgruß: „Gelobt sei Jesus Christus um ein Jesulein!“ „In Ewigkeit um zwei!“, antworteten alle. Der Vater nahm der Mutter die Kerze ab und zündete damit die Lichter am Christbaum und die schöne große Petroleumlampe über dem Tisch an. Unterdessen ging die Mutter zurück in die Küche, um das Abendessen zu holen. Dabei durfte ihr niemand helfen, damit sie das ganze Jahr über gesund bleibt und keine Hilfe bei der Betreuung der Familie nötig hat.
Das traditionelle Heilig-Abend-Essen, die „Lokitsch´n“ (gewürfelte Weißbrotstangen mit Mohn oder Käse angerichtet), duftete herrlich. Wir hatten alle mächtigen Hunger, denn dieser Tag war ein strenger Fasttag. Doch bevor wir zulangen durften, hielt der Vater eine kurze Andacht; er dankte unserem Herrgott für alle Gaben, die wir das ganze Jahr über empfangen hatten und bat um Schutz und Segen für die ganze Familie im kommenden Jahr.
Bei seinen abschließenden Worten: „Helfe Gott, dass wir auch die nächsten Weihnachten wieder gesund zusammen verbringen können!“ lief mir immer ein kalter Schauder über den Rücken. An die Möglichkeit, dass irgendwann einmal einer von der Familie fehlen könnte, wollte ich nicht denken. Von allen Speisen, die auf dem Tisch standen, wurde der erste Bissen für die „armen Seelen“ auf den Tisch gelegt und erst am nächsten Morgen eingesammelt und in das Feuer geworfen.
Gespanntes Warten auf die Geschenke
So nach und nach löste sich die festliche Stille in ein munteres Geplauder auf. Weihnachten ist ja ein Fest der Freude und wir Kinder erwarteten nach dem Essen die Gaben, die das „Jes´la“ bringen sollte. Es war nicht viel, was die Eltern den Kindern geben konnten, denn wohlhabend waren wir nicht. Die kleinen Mädchen bekamen eine Wiege mit einer Holzpuppe darin, die Buben einen Wagen mit Pferdchen davor.
Alles war aus Holz geschnitzt und bunt bemalt. Die Spielsachen wurden entweder vom Vater und den älteren Geschwistern selbst hergestellt oder auf dem Weihnachtsmarkt von den Holzschnitzern aus Kuneschhau gekauft. Die Schulkinder erhielten einen Apfel, in dem ein Geldstück steckte.
Das Christkind selbst bekamen wir Kinder nicht zu Gesicht. Es machte sich durch Glockengeklingel bemerkbar, machte die Tür einen Spalt weit auf und sagte mit heller Stimme: „Jesulein süß, mir frieren die Füß, kann nicht lange stehn, muss schnell ein Haus weiter gehn!“ Dann rief es jedes Kind beim Namen, fragte, ob es auch immer brav gewesen sei und auch beten könne. Nachdem das angesprochene Kind – oft nur mit Hilfe der Mutter – sein Gebet gesprochen hatte, bekam es sein Geschenk durch den Türspalt geschoben.
Ein besonderes Weihnachtsfest
Den Heiligen Abend des Jahres 1929 werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich war in diesem Jahr sechs Jahre alt geworden und somit schon ein Schulkind. Einige Wochen vor dem Heiligen Abend wurden meine Puppe und die Wiege ein letztes Mal in die „Weihnachtswerkstatt“ des Christkindes geschickt, um ausgebessert und farblich aufgefrischt zu werden. Ich wartete mit Herzklopfen auf das Klingelzeichen, denn ich wollte dieses Jahr dem Christkind auch eine Freude bereiten.
Zum Schulbeginn hatte ich ein Paar schöne, warme Filzstiefel für den Winter bekommen. Ich hatte also zwei Paar – und das arme Jesuskind hatte keine, denn es sagte jedes Jahr, dass seine Füße frieren. Deshalb hatte ich mich entschlossen, ihm meine alten Stiefel zu schenken. Sie waren wohl vorne etwas abgestoßen, aber warm waren sie immer noch. Es schien mir eine Ewigkeit, bis endlich der Klang des Glöckleins ertönte. Ich eilte zur Tür. „Jesulein süß, mir frieren die Füß“, hörte ich das Jesuskind sagen. „Gott sei Dank, es hat noch keine Stiefel von jemand anderem bekommen!“, dachte ich.
Vor lauter Aufregung vergaß ich das Gebet
Ich lief schnell zur Ofenbank und holte die Filzstiefel, die ich dort zum Aufwärmen bereitgestellt hatte. Bevor meine ältere Schwester begriff, was ich vorhatte, hatte ich die Tür aufgerissen und sah erschrocken auf die Gestalt, die vor mir stand. Es war kein Jesuskind, wie ich es von den Bildern her kannte. Vor mir stand ein großer Mann, der die Pelzmütze tief ins Gesicht gezogen hatte. Und die Füße waren nicht nackt und bloß – nein sie steckten in großen, warmen Pelzstiefeln. „Ich, ich wollte dem Jesulein meine Filzstiefel geben, damit seine Füße nicht frieren“, stotterte ich und schaute immer auf die großen Stiefel, die der Mann anhatte. Und diese Filzstiefel kamen mir plötzlich so bekannt vor.
Je länger ich sie anschaute, um so sicherer wurde ich: Das waren die Stiefel meines großen Bruders – und der Mann, der vor mir stand, das war mein Bruder Sepp. Ich stand da und konnte es nicht fassen. Mein Bruder hatte natürlich bemerkt, was in mir vorging. Er drückte mir die frischlackierte Wiege mit der Puppe drin in die Hand und sagte: „Sieh mal, wie schön Dein Püppchen wieder geworden ist.“ Er sprach jetzt, ohne seine Stimme zu verstellen, nahm mich an der Hand und brachte mich in die Stube zurück.
(Auszug aus: „Erinnerungen an die Weihnachtszeit in Glaserhau“ von Hanni Würch, in: „Sitten und Bräuche der Karpatendeutschen“, Stuttgart 2000.)