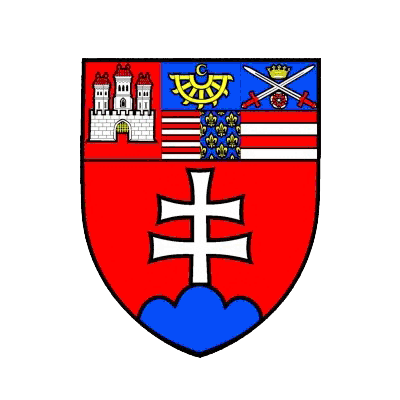Mut zum (wissenschaftlichen) Schreiben
Nach der Emeritierung (1997) wurde ich gebeten am Lehrstuhl für Praktische Theologie der Evangelisch-Theologischen Fakultät und am Lehrstuhl für Heilpädagogik sowie Lehrstuhl für Logopädie/Sprachheilpädagogik der Pädagogischen Fakultät der Comenius-Universität Bratislava mitzuarbeiten. Dann führte mich der Weg an die Pädagogische Fakultät der Konstantin-Universität Nitra, um am Lehrstuhl für Fremdsprachen den Studiengang „Deutsche Sprache“ mit aufzubauen. Bei dieser Tätigkeit als DAAD-Dozent und einem Wochenseminar mit Abiturienten der Unterzips in meinem Geburtsort Schwedler gab ich den Teilnehmern eine erste Handreichung für das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten, die 2016 in der Wissenschaftlichen Reihe des BHP-Verlags erschien ist. Im Folgenden mache ich auf grundlegende Gesichtspunkte für das wissenschaftliche Schreiben aufmerksam.
Das Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten (Bachelor-, Diplom-, Magister- oder Masterarbeiten) ist ein wesentlicher Bestandteil des Studiums. Diese Art von schriftlichen Arbeiten erfordert in der Regel eine thematisch geschlossene eigenständige Auseinandersetzung mit einer Fragestellung oder einem Problemkreis. Der Erkenntnisgewinn geschieht auf vier Ebenen:
- Wissen so wiedergeben und aktualisieren, dass es für weitere Arbeiten verfügbar ist.
- Gewonnenes Wissen daraufhin untersuchen, auf welchem Weg es entstand. Wie kommt der Autor zu dieser Aussage? In welchem Zusammenhang stehen Methode und Erkenntnis?
- Wissen zu anderem in Beziehung setzen, um neue Zusammenhänge anzubahnen.
- Erkenntnisse im Hinblick auf ihre Grenzen betrachten. Alternative Möglichkeiten für neue Erkenntnisse, Einsichten, Ergebnisse, Lösungen oder Handlungsmöglichkeiten sind aufzuzeigen. Das Ergebnis wird kritisch betrachtet und es wird Ausschau gehalten nach weiteren Möglichkeiten des Erkennens.
Hinweise zum Suchen und Ordnen der Literatur: Sinn einer zweckmäßig aufgebauten Materialsammlung ist es, Informationen optimal abrufbar zu haben für die Aufbereitung, Entwicklung und Verwertung bei den eigenen Überlegungen. Auf der Grundlage eines grob umrissenen Themas und einem allmählich zunehmend präzisen Arbeitstitel (Abgrenzung, genaue Fragestellung) sowie konkreter Vorstellungen mit Thesen und Hypothesen wird begonnen, nach Primär- und Sekundärliteratur zu suchen: Im Internet und in Bibliotheken (Wikipedia, Computerkatalog, Schlagwortkatalog, Verzeichnis der Dissertationen, Bibliographien und Autoren, Fernleihe); durch Literaturhinweise von Dozenten.
Beim Studieren der Fachliteratur und weiterer Materialien zur Thematik bewährt sich
Querlesen/kursorisches Lesen (streckenweise durchblättern oder diagonal lesen, um einen Gesamtüberblick zu erhalten und Schlüsselstellen oder Schlüsselbegriffe, Definitionen und Beispiele ausfindig zu machen) und intensives Lesen (bedeutsame Passagen für die mögliche Verwertung im Text vorbereiten).
Schlüsselfragen beim Lesen sind:
- Kann ich dieser Darstellung zustimmen?
- Welche Gedanken würde ich stärker betonen oder anders formulieren?
- Was muss ich kritisch betrachten oder gar ablehnen?
- Wie versteht der Autor die verwendeten Begriffe?
- Kann ich das Gelesene mit eigenen Praxisbeispielen belegen?
Mit solchen Fragen entstehen neue Gedanken und Sinnzusammenhänge. Sie wecken Neugierde und regen die Fantasie an: Neue Sachverhalte sind zu entdecken und werden zu noch offenen Fragen; neu erkannte Sachverhalte werden in den Argumentationszusammenhang aufgenommen; zu noch unbeantworteten Fragen ist Position zu beziehen. Dabei sind Aufzeichnungen hilfreich: Exzerpte (Argumentationsschritte der benutzten Quellen werden wörtlich oder in Thesen festgehalten); Kommentare (Äußerungen des Verfassers über einen anderen Autor werden notiert und kommentiert); Notizen (während des Lesens werden Gedanken niedergeschrieben, die zu einer Frage entstanden sind).
Hinweise zum Ordnen des Materials: Das Sammeln und Ablegen des Materials ist so zu organisieren, dass neben eigenen Aufzeichnungen auch andere Materialien (Fotokopien, Tabellen, Zeichnungen, Arbeitspläne) aufgenommen werden und verfügbar sind. Das Ordnen des Materials erfolgt
- formal nach Verfassern, Alphabet oder sachlich begründeten Stichwörtern, nach Erscheinungsjahr, nach Primärliteratur (Werke, Quellen) und Sekundärliteratur (Handbücher, Nachschlagewerke, Zeitungsartikel);
- inhaltlich nach sachlicher, historischer und systematischer Zugehörigkeit, um Art und Inhalt des Materials zu erschließen.
Der italienische Schriftsteller und Sprachforscher Umberto Eco empfiehlt eine Kartei-Sammlung nach folgendem Schema anzulegen: Lektüre-Kartei, Ideen-Kartei und Zitat-Kartei.
Als Arbeitstechnik bietet sich Mindmapping an: Gesammeltes und geordnetes Material wird um das zentrale Thema skizziert. Hauptgedanken verzweigen sich in Ästen zu Nebengedanken. Dadurch werden komplexe Zusammenhänge deutlich und es entstehen neue Ideen für die weitere Gestaltung der Arbeit – ein kaum endender Prozess.
Hinweise zum Zitieren: In der Regel wird in wissenschaftlichen Arbeiten viel Literatur zitiert: Texte, die Gegenstand der Arbeit sind, sowie andere, die diesen kritisch beleuchten. Zitate können den eigenen Gedankengang sowie die eigenen Thesen unterstützen bzw. diese kritisch hinterfragen. Eco stellt folgende zehn Regeln für das Zitieren auf:
- Regel 1 – Jene Stellen, die analysiert und interpretiert werden sollen, werden einigermaßen ausführlich zitiert.
- Regel 2 – Textstellen aus der Sekundärliteratur werden nur zitiert, wenn sie wegen ihres Gewichts unsere Auffassung unterstützen oder bestätigen.
- Regel 3 – Wer zitiert, lässt damit erkennen, dass er die Ansicht des zitierten Autors teilt, es sei denn, er bringe im Zusammenhang mit dem Zitat etwas anderes zum Ausdruck.
- Regel 4 – Aus jedem Zitat müssen sich der Autor und die Quelle […] klar ergeben.
- Regel 5 – Die Primärquellen werden, wenn möglich, nach der kritischen Ausgabe oder nach der anerkanntesten Ausgabe zitiert.
- Regel 6 – Ist ein fremdsprachiger Autor Gegenstand der Untersuchung, so wird in der Originalsprache zitiert.
- Regel 7 – Die Verweisung auf Autor und Werk muss klar sein.
- Regel 8 – Überschreitet das Zitat nicht den Umfang von zwei oder drei Zeilen, kann es im Text des Absatzes in Anführungszeichen gebracht werden.
- Regel 9 – Die Zitate müssen wortgetreu sein.
- Regel 10 – Zitieren ist wie in einem Prozess etwas unter Beweis stellen. Ihr müsst die Zeugen immer beibringen und den Nachweis erbringen können, dass sie glaubwürdig sind. Darum muss die Verweisung ganz genau sein.
Hinweise zum verständlichen Schreiben und Formulieren:
- Angemessenheit (sachlicher Stil, Verzicht auf Weitschweifigkeit, einfache und ungekünstelte Ausdrucksweise, den tatsächlichen Sachverhalt klar darstellen, Argumente gut und einleuchtend begründen, schwulstige Wendungen und gespreizte Sätze vermeiden);
- Kürze (anregende Darstellung durch kurze Sätze).
- Anschaulichkeit (Einzelheiten verarbeiten, Konkretes überzeugt und macht lebendig, überzeugende Details fesseln, anschauliche Vergleiche helfen beim Verständnis, Schlüsselbegriffe sind wichtig, Skepsis kann als Kunstgriff hilfreich sein).
- Klarheit (Hauptgedanken betonen, in anderen Wendungen wiederholen, klare Gedankengänge und logische Geschlossenheit, sprachliche und begriffliche Ordnung, Klarheit durch Beschreibung, Beispiele, Vergleich, Unterscheiden von Ähnlichem).
- Bedeutsamkeit (Interessantes, Besonderes, Exemplarisches, Bedeutungsvolles oder Originelles sollte möglichst dem eigenen Denken entspringen und entsprechend dargestellt werden).
- Beachte also: Logisch und widerspruchsfrei argumentieren; um begriffliche Klarheit und Eindeutigkeit bemüht sein; dem eigenen Stil folgen; keine Superlative verwenden und auf begründende Bindewörter achten (daher, deshalb, deswegen, darum, folglich, demnach).
Fazit: Manchmal fällt es schwer, mit dem Schreiben zu beginnen, wenn man vor dem leeren Blatt oder Bildschirm sitzt. Man weiß nicht so recht, wo und wie man am besten anfangen soll. Ein erster Schritt in die richtige Richtung können Stichpunkte sein, ebenso der Entwurf einer Gliederungsskizze. Denkbar wäre auch, mit demjenigen Textteil zu beginnen, der einen selbst am meisten interessiert. Sind dann die ersten Sätze geschrieben, ist die größte Hürde bereits geschafft und das weitere Schreiben fällt leichter.
Uni.-Prof. Dr. Dr. et Prof. h.c. Ferdinand Klein