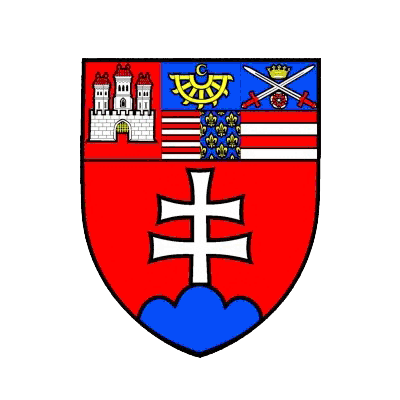Wie ich die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt habe
Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Wir haben mehrere Zeitzeugen gefragt, wie sie sich an das Kriegsende erinnern. Diese Woche können Sie auf karpatenblatt.sk jeden Tag einen kleinen Einblick in die Geschichte und sehr persönliche Geschichten bekommen. Den Auftakt macht Rosina Stolár-Hoffmann aus Pressburg.
Meine Geburtsstadt Pressburg war eigentlich bis zur „letzten Stunde“ nicht vom direkten Kriegsgeschehen bedroht. Die Versorgung funktionierte, die Propagandamaschine lief auf Hochtouren, man hörte nur Erfolgsmeldungen und veranstaltete Wunschkonzerte, die die Menschen von den schrecklichen Geschehnissen ablenken sollten. Aber dann mussten viele unserer Verwandten und Freunde „freiwillig“ einrücken – der Krieg brauchte „Kanonenfutter“. Die Familien sorgten sich um ihre Söhne und warteten auf eine Nachricht. Dann kamen die amtlichen Briefe „gefallen für Führer und Vaterland“. Was machte das für einen Sinn? Die Trauer hat alles überwogen. Diese Gefühle kann man nicht beschreiben, es entstand eine Leere, so, als ob aus unserem Denken und Fühlen alles ausradiert wäre, ich habe es an Leib und Seele persönlich erlebt.

„Niemals wieder Krieg“
Von diesem Tag an konnten wir nur bitten: „Niemals wieder Krieg“ und es blieb mir die Überzeugung, dass durch einen Krieg kein Problem gelöst werden kann. Aber der Krieg rückte immer näher. Aus der Ostslowakei wurden ganze Schulen nach Österreich und Böhmen evakuiert, viele Firmen beschlossen ihr Inventar, Waren, Maschinen, aber auch ihre Angestellten in den Westen zu verlagern. Die Apollo-Raffinerie in Pressburg wurde bombardiert und viele Häuser wurden bei dem Bombenangriff zerstört, es gab viele Tote und Verwundete. Täglich heulten die Sirenen und wir liefen in den Tunnel unter der Burg, wo wir mit hunderten Menschen in einer Finsternis, die nur mit schwachen Öllampen erhellt war, warteten. Worauf? Auf den uns vorgegaukelten „Endsieg“?

© wikipedia/František Setnička
Die Furcht vor dem Kriegsgeschehen aber auch Berichte von Übergriffen der „Befreier“, denen besonders die deutsche Bevölkerung ausgesetzt war, trieb viele meiner Verwandten und Freunde zur Evakuation in den Westen. Mein Vater behauptete noch immer vehement: „Ich habe niemandem etwas getan und mir und meiner Familie kann darum nichts passieren…“ Eine Vogel-Strauß-Politik, als ob Bomben jemals gefragt hätten, ob sie einen rechten oder schlechten Menschen treffen.
Aber am Karfreitag, vor der „Befreiung“ Pressburgs geriet er in Panik. In unserem Weinkeller lagerten einige hundert Hektoliter Wein und wenn es zu Plünderungen kommen sollte, konnte man sich vorstellen, wie sich ein betrunkener Pöbel uns gegenüber verhalten hätte. Hals über Kopf besorgte er einen Fuhrmann, der uns über Nacht in einen Ort an der March, Svätý Ján brachte. Meine gute Freundin Anni hatte dort gute Bekannte, die uns für einige Tage aufnehmen konnten. So saßen wir – Vater, Mutter, meine Tante Paula, ich und Anni mit ihrer über achtzigjährigen Mutter – auf einem von einem müden Pferd gezogenen Wagen, Richtung Malacky. Die Straße vollgestopft mit Militär. Man sah ein Gemisch aus Magyaren, Slowaken, Deutschen, alle müde, hungrig, ausgelaugt, ein erschossener ungarischer Soldat.
Das war eigentlich mein erster Kontakt zum direkten Kriegsgeschehen
In Svätý Ján angekommen, wurden wir, von diesen uns eigentlich unbekannten Menschen, freundlich für einige geplante Tage aufgenommen. Wir Frauen sollten in Svätý Ján bleiben und mein Vater mit dem Fuhrmann zurück nach Pressburg fahren. Nach den Kriegshandlungen sollte er uns dann gleich wieder nach Hause bringen. Das dachten wir in unserer Naivität. Wir verbrachten eine Nacht bei unseren Bekannten, aber am nächsten Tag, am Karsamstag, wurden wir plötzlich aus unseren Illusionen erweckt, als ein Lastwagen voll betrunkener, grölender Männer durch das Dorf fuhr, die mit verschiedenen Prügeln bewaffnet, brüllten: „Počkajte Nemci a Maďari…!“ Es entstand eine explosive Atmosphäre, die uns klar machte, dass wir aus diesem Ort sofort zu verschwinden hatten. Es begann ein trauriger Ostersonntagmorgen. An eine Heimfahrt war nicht mehr zu denken.
Der Beginn einer langen Odyssee
In unserer Hilflosigkeit hatten wir nur ein Ziel vor Augen: Wo könnten wir unterkommen? Meine Cousine, die an der Pressburger Handelsakademie unterrichtete, wurde mit der Schule im Herbst nach Hohenlehen, einem malerischen Schlösschen in Niederösterreich, evakuiert und hat dabei auch ihre Mutter mitgenommen. Und das war unser Anker, an den wir uns geklammert haben und der uns bewog weiter zu ziehen. Nach einigen Tagen und Nächten sind wir dann in Hohenlehen angekommen und unter Tränen konnten wir unsere Verwandten in die Arme schließen. Aber dann wollten wir nur schlafen, schlafen…

Mit den Bewohnern in Hohenlehen haben wir uns bald angefreundet und sie haben uns oft mit Milch und Brot geholfen. Leider wurde dann mein friedliebender Vater noch zum Heimatschutz eingezogen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er so das „Reich“ hätte retten können. Es waren einige erholsame Tage der Ruhe in einem wunderschönen Schlosspark.
In Hohenlehen war auch ein Treck von Siebenbürger Sachsen untergebracht, die mit Kind und Kegel auf Pferdewagen aus Rumänien geflüchtet waren. Wir haben uns mit ihnen angefreundet – wer weiß, wo sie gelandet sind.
Dann, am 9. Mai, der Krieg war ja eigentlich schon zu Ende, hieß es: Die Russen kommen! Wir waren am Vormittag mit meiner Tante auf der Wiese neben der Straße um Pilze zu suchen, als Lastautos und Panzerwagen mit Getöse anbrausten. Es wurde wild herumgeschossen und beim Laufen hat sich mein Mantel aufgebauscht und drei Löcher abbekommen. Wir liefen so gut wir konnten und fanden unsere zitternde Tante mit Herrn Wirt, dem dortigen Förster und noch einigen Bewohnern des Ortes, die schon eine österreichische Fahne vorbereitet hatten, mit der ich dann als die „Mutigste“ herumgefuchtelt habe. Das war eigentlich meine zweite und letzte „Kriegshandlung“.
Wie durch ein Wunder bin ich heil davongekommen
Es war wohl einer der vielen Engel, die zu meinem Schutz bestellt waren. Wir blieben noch einige Zeit in Hohenlehen, hatten viele Begegnungen mit den „Befreiern“, aber es hat uns sehr geholfen, dass wir mit unseren Slowakisch-Kenntnissen uns mit ihnen halbwegs gut verständigen konnten. Der schöne Park verwandelte sich in ein Kriegslager mit Zelten. Im Gras saßen die Soldaten, wie es schien, empfanden auch sie die erholsamen Stunden der Ruhe. Da konnte man Gesichter verschiedener Nationalitäten erkennen: Russen, Ukrainer, Kirgisen – ein klägliches Gemisch dieser zusammengewürfelten Armee.
Mit einigen Wenigen konnten wir auch sprechen und feststellen: Das sind Menschen wie du und ich, und sie haben sich korrekt zu uns verhalten. Eines Tages fragte uns ein jüngerer Major, warum wir nicht nach Hause gehen: „Ihr seid doch aus Bratislava – bratia Slovani! Ihr könnt beruhigt nach Hause gehen.“ So berieten wir uns, mein Vater sehnte sich nach seinen Weinbergen und wir beschlossen, uns auf den Heimweg, auf eine neue Odyssee zu wagen.
Wir verabschiedeten uns von unseren Freunden, haben unsere letzten Habseligkeiten liegen lassen und machten uns auf einen langen, beschwerlichen Weg. Eine Nacht in Waidhofen-Amstetten und noch einige auf verschiedenen Bahnhöfen. Immer nur ein Stück näher zur Heimat. In St. Pölten hieß es: Es geht nicht weiter, da mussten wir noch eine Nacht auf dem Perron sitzen. Meine Tante war an einer Darmvergiftung erkrankt, hatte hohes Fieber und fiel von einer Ohnmacht in die andere. Es musste etwas getan werden. Ich musste dringend wenigstens eine Tasse Tee für sie besorgen. Die habe ich so um Mitternacht in der russischen Bahnhofskommandantur besorgt. Wieder einmal war da mein sprichwörtlicher Schutzengel dabei. Aber dann hieß es auf einmal: Es kommt ein Zug nach Wien! Im Viehwagon haben wir uns mit uns bisher fremden Leuten aus Wien angefreundet, es zeigte sich wie die Not die Menschen verbindet.
Wien, o du Stadt meiner Träume
Ein Trümmerhaufen, zerbombt, müde Menschen. Wohin jetzt? Unsere „neuen“ Freunde haben uns angeboten, dass wir die Nacht bei ihnen verbringen können. Sie, selbst alt, arm und müde, haben uns Fremde angenommen, uns ihr Bett überlassen! Am nächsten Tag besuchten wir „Freunde“ aus der früheren „besseren“ Zeit, die haben uns nicht einmal einen Stuhl angeboten.
Unser einziger Wunsch: weg von hier
Ohne Papiere kommen wir nicht über die Grenze, also wieder zur Kommandantur, jedoch ohne Erfolg. Dann ein Zug nach Bratislava. Noch im Zug haben uns Mitreisende gewarnt: Geht nicht in die Stadt durch den Haupteingang des Bahnhofes. Dort wartet die Polizei und es geht ins Lager Petržalka/Engerau zu einer Monate langen Internierung und, wenn man Glück hat, wieder direkt an die österreichische Grenze. So krochen wir auf allen Vieren auf der hohen Böschung vom Bahnhof auf die damalige Tunnelzeile. Dort trafen wir unser ehemaliges Hausmädchen, das uns über unsere aussichtslose Situation informierte. Zum Glück kam auch noch die Schwiegertochter meiner Tante dazu, die uns mitteilte, dass ihre Wohnung ausgeplündert wurde und bereits von neuen Bewohnern besetzt sei, man hat sie einfach rausgeworfen. Sie ist bei ihren Eltern, die im Wohnviertel Kramer ein Familienhäuschen hatten, untergekommen und hat uns dann auch gleich zu ihnen mitgenommen – für ein paar Tage. Im Haus war eigentlich nur Platz für zwei/drei Personen. Sie waren Vater, Mutter, Sohn und dann noch die Tochter. Wir waren fünf Erwachsene. Bis heute ist es mir unverständlich, wie wir dort alle gehaust haben.
Gleich wurde mir die Situation bewusst
Nachdem ich von einem Bekannten eine Militärdecke bekommen habe, bin ich in den Ziegenstall übersiedelt. Die Ziege war recht freundlich, sie wohnte „ebenerdig“ und ich quartierte mich über ihr ein. Nach einigen Tagen ist dann auch mein Vater zu mir gekommen und dann noch ein Untermieter, sein Bruder, aber der ist dann bald zu seiner Familie nach Deutschland abgehauen.
Nach einigen Tagen fasste ich Mut und bin in unser Haus auf der Schöndorferstraße gegangen. Die Wohnungstür im ersten Stock war sperrangelweit offen und ich ging durch die menschenleere Wohnung. Niemand zu sehen. Alles war so, wie ich es gewohnt war an demselben Platz, die Möbel, sogar die Bilder an der Wand, nur einige Kleidungsstücke verrieten einen neuen Besitzer. Es war unheimlich und ich habe mich nicht getraut etwas anzurühren.
Am nächsten Tag war die Tür abgeschlossen, als ich noch einmal kam. In einem Gefühl von Angst und Wut habe ich mit beiden Fäusten auf die Tür eingeschlagen, aber eine Frauenstimme forderte mich auf, sofort zu verschwinden.
Hoffnung ade!
Auf der Straße habe ich dann fürchterlich geweint. Das war mein letztes „Kriegsereignis“. Im Kramer bei unseren Verwandten sind wir bis zum Herbst geblieben, aber als dann die Nächte kälter wurden, war es aus mit meiner Sommerfrische, mit meiner Ziege. Auf abenteuerliche Weise sind wir dann bei entfernten Verwandten in der Innenstadt untergekommen. Wohl war auch wieder mein Schutzengel dabei. Es waren zwei ältere Damen, die Ilonka- und die Margitnéni. Sie haben uns aufgenommen, auch wenn ihnen bewusst war, dass dies mit großen Risiken verbunden war. Unsere Ilonkanéni hat bei verschiedenen Razzien, die man im Haus durchgeführt hat, immer vehement behauptet „Tu nie sú žiadni Nemci.“ Einstellung zu Mitmenschen, die Hilfe benötigten.
Es war nicht ganz einfach, aber mit viel christlicher Liebe und Entgegenkommen konnten wir sogar fast zwei Jahre bleiben. Wir haben uns finanziell mit Handarbeiten über Wasser gehalten, haben aus Stoffresten Taschen genäht, die in der Nachkriegszeit sehr gefragt waren, da in den Geschäften nichts zu kaufen war. Den Winter haben wir irgendwie mit Kleidungsstücken, die uns von Bekannten geschenkt wurden, überlebt.
Aber die Verfolgung der Deutschen hörte nicht auf
Die Razzien verliefen so, dass an jeder Straßenecke jeweils zwei Uniformierte und ein Zivilist standen und wer sich nicht ausweisen und auch nicht gut Slowakisch sprechen konnte, wurde auf einen Lastwagen aufgeladen und ins Lager transportiert. Die Tore des Lagers „schmückte“ die Aufschrift „Sústreďovací Tábor pre Nemcov“ – Sammellager für Deutsche. In Pressburg war es in der „Patronka“ in einer aufgelassenen Fabrik mit Lagerhäusern. In Nováky war wohl eines der größten in der Slowakei. Dort waren viele Deutsche aus der Zips, aus dem Hauerland und auch Pressburg Jahre lang interniert.
In Pressburg konnte man beobachten, wie über die Pontonbrücke oft ganze Familien mit Kindern und Handwägelchen, auf denen sie ihre letzten Habseligkeiten aufgeladen hatten, getrieben wurden. Allzu oft kam es vor, dass man ihnen dann auch noch dieses Letzte abgenommen hat. Im Lager hausten alte und junge Menschen, Männer und Frauen, Kinder auf bloßem Boden. Arbeitsfähige Männer wurden morgens nach dem Appell zu verschiedenen Arbeiten aufgeteilt. Die, die in der Nacht gestorben sind, wurden einfach weggetragen. Wohin man die Toten und Kranken gebracht hat, weiß niemand und noch heute suchen manche vertriebene Landsleute nach Spuren ihrer Verwandten, die während des Lageraufenthaltes verschwunden sind. Diese Jahre der Verfolgung und Erniedrigungen haben in den Menschen viele Wunden hinterlassen, die zwar verheilt und vergeben sind, aber niemals vergessen werden.
Soweit meine Erinnerungen, welche auch in meinem Buch nachzulesen sind. Wenn ich auch direkte Kriegshandlungen nicht erlebt habe, so hat diese Zeit auch mich zu einem neuen Menschen geformt und mich bewegt, Jahrzehnte lang meinen Landsleuten in der Gemeinschaft der Karpatendeutschen neue Lebensfreunde und Selbstachtung zu schenken.
(st)