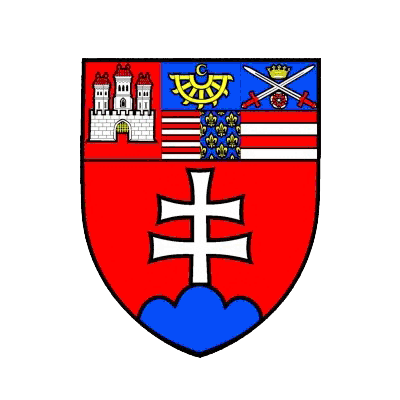Meine Flucht 1944 aus der Slowakei
Ich bin am 21. Februar 1927 in dem schönen Schwedler unter der Hohen Tatra geboren; es war ein friedliches Dorf. Ich bin mit einem Bruder und einer Schwester groß geworden. Wir hatten eine schöne Kindheit, es fehlte nicht an Essen und Kleidern, meine Mutter nähte uns schöne Sachen. Vom Krieg wussten wir nichts, denn es gab kein Radio und keine Zeitung.
Ich bin acht Jahre in die Volksschule gegangen. Als ich hörte, dass sie Mädel für den Haushalt in Deutschland suchten, habe ich mich gleich gemeldet. 1942 kam ich dann mit einem Transport nach Oldenburg zu dem Metzgerehepaar Lüppen. Ich hatte es gut, aber ich musste mit 15 Jahren sehr viel arbeiten.
Zu Weihnachten fuhr ich nach Hause
Wir hatten den Pass für ein Jahr. Frau Lüppen versprach mir viel Gutes, wenn ich zurückkomme; ich ging nicht zurück, sondern nach Hildesheim, dort war meine Cousine. Sie war in einer Pension mit 20 Kindern, sie brauchten noch jemanden, weil die Arbeit für ein Mädchen zu viel war. Jetzt waren wir wieder zu zweit, jeden Tag die Zimmer aufräumen, alle drei Wochen Betten beziehen, in der Küche helfen. Wir hatten immer viel Wäsche zu waschen, wir mussten ganz schön schuften, für 20 Reichsmark im Monat, meine Cousine bekam 30 Reichsmark, sie war älter. Nach eineinhalb Jahren hatte ich Heimweh und wollte nach Hause. Mein Vater war damals in Benefeld auf Arbeit, denn in der Slowakei war wenig Industrie, so musste man nach Deutschland. Wir trafen uns in Hannover und fuhren Richtung Heimat, die Züge waren sehr voll, die Männer mussten zu den Fenstern rein und Platz halten, damit wir die lange Fahrt sitzen konnten.
Wir wollten vier Wochen zu Hause bleiben. Vater fuhr zurück, ich verlängerte meinen Pass noch drei Wochen, denn meine Mutter war sehr krank geworden. Nach sieben Wochen wollte ich zurück und fuhr mit dem Zug los, aber ich kam nicht weit, die Brücken waren von den Partisanen gesprengt. Ich musste wieder nach Hause. Das war gut so, denn meine Mutter wurde wieder krank. Die Verwandten taten sich zusammen, um die Kartoffeln für den Winter zu ernten. Es war schon sehr unruhig, man hörte die Partisanen schießen. Als wir auf unserem Acker die Kartoffeln ernteten, da hörten wir von weitem meinen Cousin, damals zehn Jahre, weinen. Er kam und sagte, ihr müsst gleich nach Hause kommen, die Partisanen hängen die Deutschen an die Autos und schleifen sie zu Tode.
Im Nachbarort ist es schon geschehen, bei uns war ein Dorf vom anderen circa neun/zehn Kilometer weiter. Wir fuhren gleich nach Hause, da wurde schon bekannt gegeben, dass in zwei Stunden alle auf die Autos im Ort sollten, der Wagen mit den Kartoffeln blieb im Hof stehen, das Vieh schrie, die Hunde bellten, es war grausam. Wir konnten nur das Notwendigste mitnehmen, die Leute rannten umher wie ohne Verstand; es wollte keiner fort. Wir stiegen auf die Busse, fuhren bis Zakopane, von dort weiter mit den Zügen.
Auf einmal hieß es, alles unter die Züge, denn wir wurden von den Fliegern beschossen. Dort fand ich ein kleines Kreuz, das hielt ich fest in der Hand gehalten und betete – ich habe es heute noch. Abends bekamen wir die erste Suppe vom Roten Kreuz. Wir mussten über Nacht dort bleiben, in der Früh fuhren wir weiter mit dem Zug nach Römerstadt unter dem Altvater-Gebirge. Von dort brachten sie uns mit einem Kohlenauto in das Lager. Es regnete sehr, wir sahen aus wie die Kaminfeger als wir in Altendorf im Lager ankamen. In dem Lager waren wir etliche Wochen. Die Leute wurden krank. Wir wurden dann in die Häuser verteilt, von Bruder, Schwester und Vater wussten wir nichts.
Die Schwester hatten sie mit der ganzen Schule nach Österreich evakuiert, meine Mutter hörte dann, dass es den Kindern in Österreich nicht gut geht, die russischen Truppen kamen immer näher. Sie entschloss sich, nach Österreich zu fahren, um meine 13-jährige Schwester zu holen. Unsere Verwandten und wir wollten zu den Amerikanern, denn wir hörten, dass die Russen die Mädchen und Frauen vergewaltigen und schlagen. Wir fuhren los mit Pferdegespannen.
Es war die Hölle
Flüchtlinge und Soldaten lagen mit Kopfschuss am Straßenrand, Panzer fuhren über Menschen und Pferde, das Blut floss auf der Straße, die Menschen schrien. Es wurde geschossen, die Wagen angezündet, Frauen und Mädchen vergewaltigt. Wir liefen über die Felder in das Dorf Mendrig in eine Scheune, die offen war. Unterwegs zündete das deutsche Militär noch Berge von Munition an, damit nichts in russische Hände kam. Als wir in der Scheune waren, kam die Bauersfrau und sagte auf Tschechisch, wir sollten ruhig sein, denn die Polen im Hof sind so betrunken, wenn die uns sehen, erschlagen sie uns. Wir verhielten uns ganz ruhig. Draußen hörten wir die Menschen um Hilfe rufen.
Die Tschechen brachten dem russischen Militär Körbe voll Kuchen. Wir blieben über Nacht bei der Bäuerin in der Scheune, sie kam als die Polen schliefen. Sie hat uns im Heu hinter der Futterschneidemaschine versteckt. Wir hatten Angst, dass uns die Tschechen finden. In der Früh bei Zeit kam die Bäuerin und sagte, wir müssten weiter, denn wenn die Polen erwachen, ist es sehr gefährlich für uns. So sagte sie noch, wenn wir Bilder oder Pässe mit dem Hakenkreuz haben, sollten wir ihr alles geben, sie bäckt Brot und schmeißt es in den Ofen, denn wenn sie bei uns das finden, erschlagen sie uns.
Wir fuhren los Richtung Römerstadt. Die Rückfahrt war grauenhaft, es regnete, wir waren nass, die Kinder weinten, wir dachten oft, es geht nicht mehr weiter.
In Römerstadt angekommen
Jetzt dachten wir, der Krieg ist aus, wir können nach Hause fahren, ein paar Kartoffeln für den Winter anbauen. Mutter und Schwester, Tante und Cousin blieben dort in Römerstadt, denn sie waren krank von der Reise. Onkel, Cousine mit Familie und ich, wir fuhren los Richtung Heimat. Unterwegs wurden wir wieder oft angehalten, sie kontrollierten die Ausweise. Zum Glück hatten wir nur den slowakischen Ausweis bei uns, das rettete uns das Leben.
Es wurde oft das Gewehr auf uns gerichtet. Die Angst kann man sich nicht vorstellen, die uns begleitete. So fuhren wir weiter über Felder und Wiesen. Jetzt waren wir bald in Schwedler in der Heimat. Wir freuten uns sehr, da ging aber das Leiden weiter. Wir wurden von Hirten und Kommunisten in Empfang genommen und in die Schule, in die wir acht Jahre gingen, eingesperrt. Jetzt mussten wir eine Armbinde tragen, weiß mit einem schwarzen N darauf, dass bedeutete Nemci (Deutsche). Nach ein paar Wochen kamen immer mehr Leute nach Hause, da brachten sie uns in andere Lager, nach Jaklovce. Dort schliefen wir etliche Wochen auf Zementboden, wo früher das Vieh war. Wir schliefen mit den Kleidern, die wir noch hatten, in der Früh waren wir zusammengefroren und konnten kaum laufen.
Es gab nichts zu essen und zu trinken
Wer noch Schmuck oder Stoffe hatte, tauschte es, um zu überleben. Aber es war nicht mehr viel, was die Leute hatten, denn die Russen hatten ja alles weggenommen. Sie fingen an, die Leute wieder in andere Lager zu verteilen. Einige gingen nach Schmöllnitz in den Peckengrund, um im Wald zu arbeiten. Da war ich dabei. Frauen und Kinder gingen nach Einsiedel, neun Kilometer von unserem Dorf entfernt. Dort sind viele an Hungertyphus gestorben. Die Alten und Kranken kamen nach Bad Turzo in Göllnitz. Eines Tages, bevor wir fort kamen, wurde ich in die Straßmitta (Büro) gerufen. Ich hatte große Angst, was sie von mir wollten. Als ich rein kam, stand mein Bruder da, mager und zerrissen. Wir weinten sehr; sie fragten mich, ob ich den kenne. Ich sagte „ja“, denn ich konnte schon etwas Slowakisch. Er durfte dann bei mir im Lager bleiben, er war ja erst 15 Jahre alt. Wir wussten nicht, wo unsere Eltern waren.
Als wir dann im Arbeitslager im Peckengrund waren, erfuhren wir, dass die Eltern und die Schwester zusammen waren, sie trafen sich durch Zufall in Römerstadt am Bahnhof. Sie kamen nach Österreich ins Arbeitslager. Wir mussten jeden Tag alle bei Hunger arbeiten. Abends haben wir Blut gebrochen, denn der Magen war schon sehr schwach. Dort arbeiteten wir bis Herbst. Es war schon sehr kalt, wir hatten keine warmen Kleider und Schuhe, sie hatten uns ja alles weggenommen.
Es wurden viele krank. Sie brachten uns dann in Schmöllnitz ins Toflerhaus, dort war es etwas besser. Wir lagen auf Holzpritschen. Sie brachten noch deutsche Frauen mit Kindern vom Ort zu uns.
Es war bald Weihnachten
Die Frauen haben Stoffreste von Bekannten aus dem Ort erbettelt, damit wir den Kindern etwas zu Weihnachten basteln konnten. Wir machten schöne Puppen und Harlekins aus den Resten. Die Kinder haben sich am Heiligen Abend sehr gefreut und wir mit ihnen. Meine Eltern und meine Schwester waren in Österreich und mussten in Melk Bombentrichter zuschütten. Es wurden auch dort viele Leute krank. Sie bekamen Hungertyphus – auch meine Mutter und meine Schwester, das erfuhren wir erst später. Meine Schwester verlor die ganzen Haare vom Kopf.
Eines Tages sagte der Vater meiner Freundin, Herr Krieger, er habe drei Kinder im Lager. Die Leute gaben ihm dann etwas Brot oder Milch, denn das Geld ging ja ins Lager. Wenn er abends kam, teilte er es mit Frau, Kind, meinem Bruder und mir. Das hat uns das Leben gerettet. Eines Abends sagte er: „Ich haue ab, dann schaue ich nach einem Platz für euch, denn hier gehen wir kaputt.“ Tatsächlich war Herr Krieger in der Früh weg, es fragte keiner, wo er war, wir wurden nicht mehr so arg bewacht. Nach einer kurzen Zeit bekamen wir Post, er schrieb, wir sollten kommen. Nachts, als alle schliefen, gingen wir raus. Abends haben wir uns schon vorbereitet, mein Bruder und ich. Wir ließen uns mit einem Strick von der Mauer runter und liefen ganz schnell weg.
Wir gingen durch einen Wald. Es war sehr dunkel, jedes Geräusch schreckte uns auf. Nachts kamen wir bei meinen Großeltern an, die hatten sich in ihrem Haus einen Raum etwas hergerichtet, aber sie mussten später wieder raus, die Lager hatten sich so langsam aufgelöst, weil sie für die Leute nichts zu essen hatten. Früh bei Zeit sind wir wieder zum Zug, Richtung Eperies/Prešov, denn wir wussten, dass sie uns bei den Großeltern suchen würden. So war es auch. Meine Großeltern sagten, da war niemand, meiner Freundin ihr Vater hatte für jeden einen Platz bei Juden. Nur mein Bruder war auf einem Dorf in einer Mühle als Knecht. Jetzt waren wir wenigstens in Eperies und frei, etwas Angst hatten wir schon bei Juden zu sein. Nach einem halben Jahr kam meine Freundin und sagte, meine Eltern hätten geschrieben, wir müssten nach Nováky ins Sammellager, denn die stellten die Transporte nach Deutschland zusammen. Wir sagten es den Familien, bei denen wir im Haushalt waren, sie haben uns gehen lassen.
Wir fuhren mit dem Zug nach Nováky ins Lager
Dort waren wir wieder etliche Wochen, bis die Transporte zusammengestellt wurden. Wir kamen mit den Großeltern, einer halbblinden Tante und einem ganz blinden Onkel nach Dammgarten bei Strahlsund in die Baracken. Dort war es nicht gut, nachts kamen die Russen. Wenn wir hörten, dass einer rief: „Die Russen kommen“, lagen mein Bruder und ich schon unterm Bett, meine Tante legte sich in unser Bett, denn wir schliefen zu zweit in einem Bett, es war nicht viel Platz.
Wenn sie die Türe öffneten und die alten Leute sahen, gingen sie weiter. Großmutter sagte, ihr müsst eure Eltern suchen, sie gab uns 5 Mark. Die musste man einschicken, wenn man jemanden suchte. Das Rote Kreuz schrieb uns im Oktober 1946 und schickte uns die Adresse von unseren Eltern. Ich habe gleich geschrieben, sie waren schon in Unterschüpf, Kreis Tauberbischofsheim.
Wir freuten uns, dass wir wussten, sie leben. Ein Cousin von meiner Mutter kam ins Lager und sagte, wenn ihr wollt, nehme ich euch mit, aber es ist nicht ungefährlich, ich gehe schwarz über die Grenze. Mein Bruder wollte erst nicht, er hatte Angst. Wir fuhren von Stralsund Richtung Salzwedel. Vor der Grenze mussten wir noch einmal umsteigen. Wir lagen auf der Lauer und wir hatten Glück, da rannten wir so schnell wir konnten zum Zug am Bahnsteig. Er hatte schon gepfiffen, ich fiel in den Waggon rein und bekam kaum noch Luft, aber wir waren alle drei drinnen. Wir fuhren bis Salzwedel. Dort stiegen wir aus. Es wurde Nacht, die Kälte klirrte, der Schnee war wie weißes Tuch.
Auf der anderen Seite war ein kleiner Wald, dort liefen wir rein, damit wir nicht gesehen werden konnten. Wir gingen weiter bis wir zu einer Wirtschaft kamen, der Verwandte kannte die Familie schon und rief. Sie schauten aus den Fenstern, die Frau sagte: „Wir machen nicht mehr auf, in der Früh müssen wir bei Zeiten raus. Geht in den Stall, dort ist Stroh, deckt euch zu.“ Wir lagen fest einer an den anderen. In der Früh waren wir zusammengefroren von der Nacht. Der Gastwirt kam und sagte: „Gebt mir jeder 5 Mark, dann fahre ich euch bis zum Bahnhof.“ Es war ja noch weit bis zum Bahnhof, wir gaben ihm das Geld, er sagte: „Ich binde Stricke an den Wagen und ihr haltet euch daran fest, damit ihr euch warm laufen könnt.“ Er trabte ganz leicht mit dem Pferdewagen, als wir warm waren, ließ er uns aufsteigen, so kamen wir an den Bahnhof. Dort hat uns das Rote Kreuz den ersten warmen Tee gegeben. Von dort fuhren wir Richtung Hannover; dort angekommen warteten wir die ganze Nacht im Bahnhof auf den Zug nach Heidelberg. Wir hatten Angst, denn dort trieben sich Polen herum und haben den Leuten die Koffer geklaut.
Sie kamen auch zu uns. Wir taten, als verstünden wir nichts. Als der Zug früh ankam, war er sehr voll. Die Leute drückten einen hinein.
Wir waren froh, als wir drinnen waren
Im Zug Richtung Unterschlüpf war es kalt, die Fenster kaputt. Als wir in Unterschüpf am Bahnhof ausstiegen, waren wir glücklich, aber die Hände waren geschwollen vom Koffer tragen. Als wir mitten im Ort waren, lief uns unsere Nachbarin von zu Hause über den Weg. Sie war erschrocken, als sie uns sah. Sie führte uns zu unseren Eltern. Meine Schwester war allein zu Hause, Vater war in der Arbeit, Mutter zum dritten Male in Tauberbischofsheim, wegen der Zuzugsgenehmigung. Wir legten uns auf den Boden, um etwas zu schlafen, denn wir waren total erschöpft.
Um 11.30 Uhr holte meine Schwester die Mutter am Bahnhof ab. Sie sagte nicht, dass wir schon da waren. Als sie uns in der Küche liegen sah, schrie sie, denn sie dachte, es ist Vater etwas passiert. Wir waren gleich wach. Alle haben geweint, aber sie freute sich sehr, dass wir schon da waren.
Wir weinten viel
Mutter ging wieder aufs Rathaus, denn so ging es nicht weiter. Sie haben mich dann zum Zahnarzt-Handwerker in den Haushalt geschickt und meinen Bruder zum Bauer Ulmerich als Knecht. So verging ein halbes Jahr. Mutter ging zu den Bauern arbeiten, sie tat mir sehr leid, denn sie war von der Flucht nicht mehr gesund und sehr mager. Wir hatten Angst, dass sie stirbt. Meine Schwester hatte eine Stelle als Schneiderin, der Bruder bekam nach langer Suche als Bäcker einen Platz. Er hatte es nicht gut bei dem Bäcker; ich musste in die Schuhkappenfabrik nach Lauda. Vater verdiente damals nicht viel. So musste ich den Haushalt mit unterstützen, weil ich die Ältere war. So waren wir alle untergebracht.
1951 heiratete ich meinen Mann Josef Kraus aus Unterschüpf. 2001 hatten wir Goldene Hochzeit. Wir danken Gott, dass er uns bis hierher begleitet hat, es war ein sehr steiniger Weg. Aus der Slowakei sind tausende Menschen verhungert oder erschlagen worden. Von den Slowakei-Deutschen hört man nicht viel, obwohl wir als Erste vertrieben wurden. Darum habe ich unsere Vertreibung niedergeschrieben, damit unsere Enkel mal wissen, was sie mit den Deutschen gemacht haben.
Julie Kraus, geborene Gastgeb
(aufgeschrieben 2001 in Boxberg-Unterschüpf)