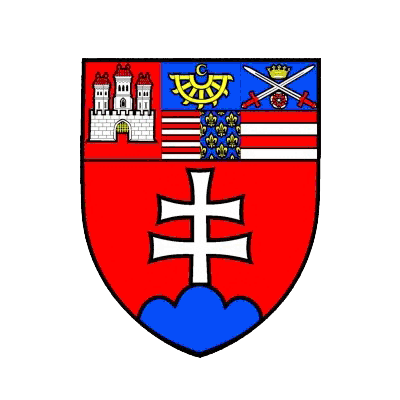Warum es so wichtig ist, Zeitzeugen zu befragen
Es ist nicht nur wichtig, Zeitzeugen zu befragen, sondern, wenn sie denn etwas erzählen, dieses auch aufzuschreiben oder aufzunehmen und äußerst gut zuzuhören. Damit es zumindest mündlich richtig und unverfälscht an die Nächsten weitergegeben werden kann. Denn ohne das Wissen derer, die Schlimmes erlebt haben und ohne das Weitergeben ihres Erlebten, bleibt ein lebendig Erhalten der damaligen Geschehnisse unmöglich. Denn nur so können sowohl Fehler aus der Vergangenheit in der Zukunft vermieden als auch Positives und Gutes in die Zukunft gerettet werden.
Der Zweite Weltkrieg gehört zweifelsohne zum Schlimmsten, was der Mensch an Schrecken, Angst, Verbrechen, Tod, Not und Elend verursachte. All denjenigen, die diese furchtbare Zeit erlebt haben, fällt es sehr schwer, davon zu erzählen oder sich zu erinnern. Ein Sprichwort sagt: „Zeit heilt alle Wunden“. Doch die meisten, selbst wenn sie Jahre später von den Kindern oder Enkeln gefragt wurden, haben nur sehr wenig bis gar nichts aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs erzählt. Zu viel von dem Erlebten war für die Betroffenen, selbst nach der langen Zeit noch, zu schrecklich, um von sich aus davon erzählen zu wollen. Für viele kam zu all dem Leid und Not auch noch der Verlust der Heimat hinzu. Diese Menschen waren dann besonders hart vom Schicksal getroffen, denn die alte Heimat, ob freiwillig oder unfreiwillig, musste verlassen werden. Zu allem Übel lag dann aber auch noch die neue Heimat in Schutt und Asche.
Eine eigene Erkenntnis
Bei einer meiner Nachforschungen über meine Familie und Matzdorf sprach ich am Telefon mit der Enkelin eines ehemaligen Matzdorfers. Auf mein Nachfragen nach ihrem Vater oder Großvater, sagte sie mir, dass ihr Großvater längst verstorben sei. Auf meine Frage, ob sie denn Interesse an der alten Heimat habe oder ob sie alte Fotos von Matzdorf und ihrer Familie besäße, antwortete sie mit: „Nein“. Als ich fragte, ob denn ihr Herr Großvater überhaupt irgendwas über früher in Matzdorf oder der Zips erzählt habe, sagte sie: „Nein“. Wie auch: „Mein Großvater hat überhaupt nicht darüber gesprochen. Wissen Sie, er gehörte zu denen, die von dort vertrieben wurden und er hat zu sehr unter dem Verlust der Heimat gelitten. Er verstarb bereits in den 1980ern, als gebrochener Mann. Er hat bis zum Schluss geglaubt und gehofft, eines Tages wieder zurückkehren zu dürfen. Er ist regelrecht daran zugrunde gegangen.“
Weder bin ich ein Historiker noch ein Zeitzeuge, daher kann ich mir nicht wirklich erlauben, ein gerechtes Urteil über die eine oder über die andere Seite zu fällen. Genauso wenig kann ich mit Sicherheit sagen, wie ich mich zu jener Zeit verhalten hätte. Doch ich kann sehr gut verstehen, warum besonders noch kurz vor und kurz nach dem Krieg, vielerorts Unrecht mit Unrecht vergolten wurde.
Persönliche Erinnerungen anderer können immer leicht verfälscht sein. Der Mensch vergisst eben mit der Zeit auch einiges. Ich habe besten Gewissens versucht, hier all das wiederzugeben, von dem mir mein (2007 verstorbener) Vater berichtete und an was ich glaube, mich zu erinnern.

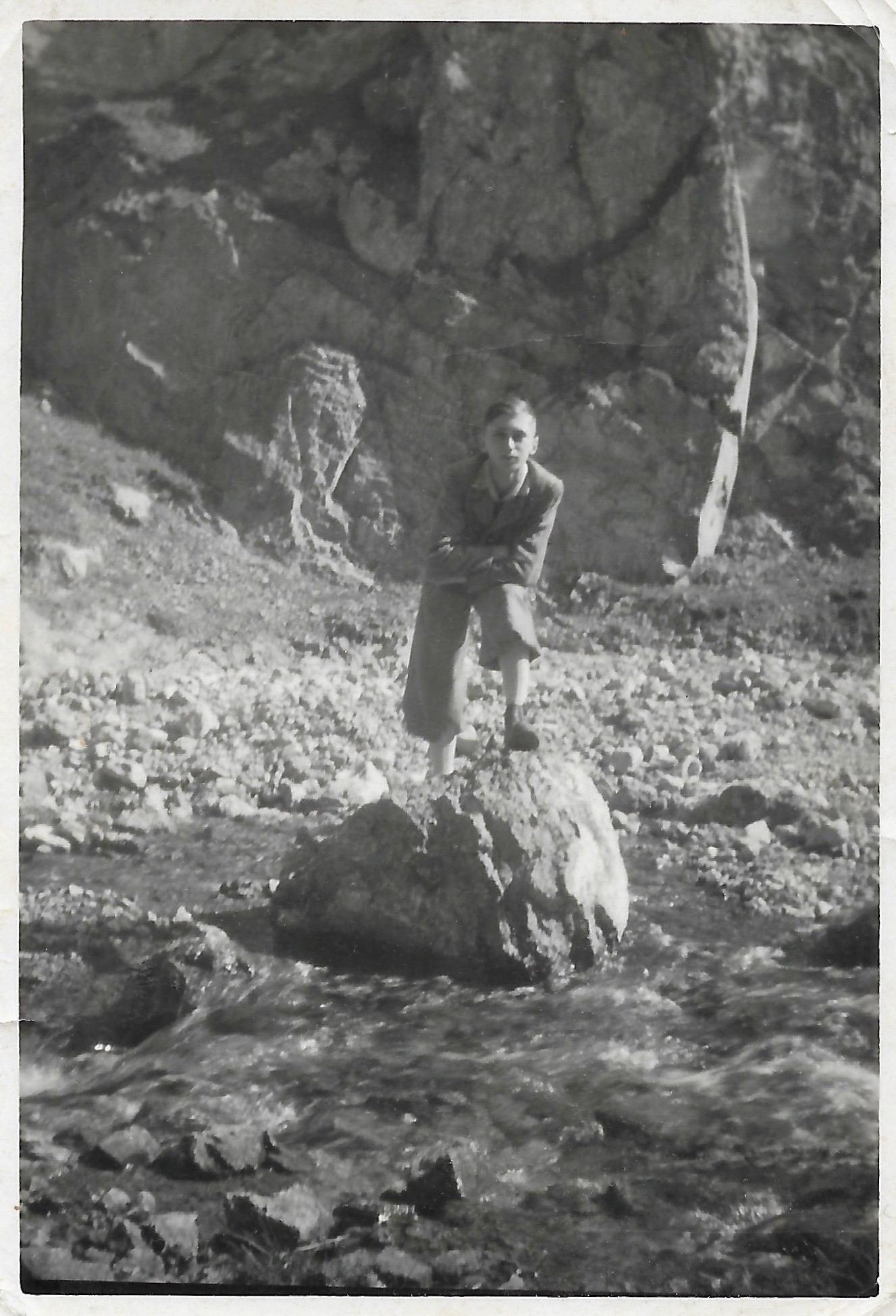
Was ich darüber von meinem Vater weiß
Mein Vater gehörte zu denen, die im Herbst 1944 (mit 13) aus der Zips noch evakuiert wurden. Dies erzählte er mir so nebenbei, wie anderes von damals. Meistens dann zu einem bestimmten Datum. Einmal, auf dem Weg nach München, fragte er mich, was für ein Tag sei. „Heute ist der 6. Dezember“, antworte ich. „Der 6. Dezember“, wiederholte er langsam. Nach einer kurzen Pause sagte er: „Am 6. Dezember 1944 bin ich in Markt Schwaben angekommen. Zuerst ging’s im November rauf nach Zakopane. Von dort dann über Polen mit dem Zug rüber ins Sudetenland und von da dann runter nach Bayern. Circa zwei Wochen später war ich dann in Markt Schwaben.“
In München angekommen, wie jedes Mal, wenn wir in München waren, erzählte mir mein Vater dann, wo welches Haus wie stark zerbombt war. „Schau, hier das Haus da, war so halb kaputt. Das da war nur leicht beschädigt, bei dem war nur des Dach etwas kaputt. Und das da hinten und all die anderen dahinter waren ganz zerstört. Da stand kein Stein mehr auf dem anderen. Und dort drüben stand die Fassade nur noch so halb“ Damals habe ich mir dann oft gedacht: „Sag’s noch dreimal.“ Jetzt wäre ich froh, wenn er es mir doch wenigstens, bitte, bitte, nur einmal noch erzählen könnte.
München war so dermaßen zerstört, dass man nach dem Krieg echt überlegte, es an anderer Stelle komplett neu zu errichten. Er erzählte mir dann auch, dass, immer wenn München bombardiert wurde, der Himmel über München lichterloh erhellt war und man dies von Markt Schwaben aus, ganze 25 Kilometer entfernt, auch sehen konnte. Zumal dann in Markt Schwaben auch noch die Barackentür auf und zu flog.
Auch auf Markt Schwaben wurden zwei Bomben abgeworfen und zwar auf die Gleise am Bahnhof, wusste mein Vater mir zu berichten. Die Bombardierung der Städte, somit die Bombardierung der Zivilbevölkerung, empfand mein Vater stets als eine schier unbeschreibliche Ungerechtigkeit. Als Jugendlicher dachte ich dann stets: „Das war eben die Quittung für euer Scheiß-‚Heil Hitler!’“
Wann immer wir in München an einem bestimmten Lokal vorbeikamen, gestand er mir, dass in jenem Lokal nach dem Krieg, Ende der 1940er Jahre, bei einer Halben oder zwei manchmal die Berufsschule geschwänzt wurde. Hin und wieder gingen er und seine Kameraden aber auch abwechselnd in zwei bestimmte, einander schräg gegenüberliegende Cafés. Bis eines davon einstürzte. Was dann auch gerade in dem Moment geschah, als sie sich in dem anderen Café hinsetzten. Und eben jenes Café wurde an diesem Tag, obwohl alle anderen dorthin wollten, von meinem Vater aus unerklärlichen Gründen vehement abgelehnt. Er sagte: „Was ihr macht, ist mir Wurst! Ich will da nicht rein“, und ging in das andere Café. Seine Kameraden folgten ihm doch noch nach und kaum nahmen sie Platz, stürzte das andere Haus (und das obwohl der Krieg schon einige Jahre vorbei war) mit dem Café ein.
Wie war es damals?
Als ich als Kind einmal fragte, wie es nach dem Krieg war, antwortete er mir: „Kind, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir mussten buchstäblich stehlen, um was zum Fressen zu haben.“ Dann erzählte er mir, wie er und andere als Kinder Altpapier sammelten und sie die Zeitungen und Zeitschriften in der Mitte nass machten, damit sie schwerer wurden, denn sie bekamen das Altpapier damals nach Gewicht bezahlt.
An meinem 17. Geburtstag stellte mein Vater fest: „Jetzt bist du schon 17! Als ich 17 war, da war gerade die Währungsreform. Da hat’s das neue Geld, die D-Mark, gegeben. Plötzlich konnte man über Nacht wieder alles kaufen, wenn man das Geld dazu hatte.“
Auf meine Frage als Kind, wo er damals in Markt Schwaben unterkam, antwortete mein Vater: „Auf dem alten Sportplatz, da sind damals die Baracken für die Flüchtlinge gestanden. Markt Schwaben wurde seinerzeit mit den Flüchtlingen, die hauptsächlich aus dem Sudetenland stammten, regelrecht groß“. Er war der einzige Karpatendeutsche und von meiner Mutter weiß ich, dass mein Vater damals todunglücklich war und nichts sehnlicher wollte, als wieder zurück in die alte Heimat.
Sehr wenig Geld als Lehrling
Als ich als Lehrling einmal (1991) feststellte, dass 700 Mark Brutto in der Spitzenhotellerie nicht gerade viel sind, meinte mein Vater, es sei schon viel Geld für einen Lehrling: „Stell dir vor! Als Malerlehrling nach dem Krieg hab‘ ich im ersten Lehrjahr gerade mal 5 Mark die Woche bekommen. Und vom Meister hast noch eine saubere Ohrfeige bekommen, wenn du was falsch gemacht hast. Du kannst dir jeden Tag eine Schachtel Zigaretten kaufen. Zu meiner Zeit habe ich von einer Zigarette vor der Arbeit nur ein paar Züge geraucht und sie dann mit Spucke auf dem Finger wieder ausgemacht. Die andere Hälfte hab‘ ich dann nach der Arbeit geraucht. Wir mussten damals bei uns mit allem sparen.“
In Kesmark
Schon in der Zips war mein Vater und später auch in Deutschland bis Kriegsende in der Hitlerjugend. Darum sind mir Begriffe wie „Wunderwaffe“ oder „Sabotage“ auch schon früh ein Begriff gewesen. Als wir einmal eine Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg sahen, in der es auch darum ging, dass viele Deutsche sagten, sie hätten nichts von der „Endlösung“ gewusst oder davon, dass man in den Konzentrationslagern Juden tötet, selbst wenn sie in unmittelbarer Nähe eines KZ wohnten. Sie hätten einfach gedacht, sie müssten dort hart arbeiten. Der Kommentar meines Vaters dazu ruhig, aber mit fester Stimme: „Jeder, der behauptet, dass er nicht gewusst hat, dass es den Juden an den Kragen geht, der lügt!“ Er fügte aber hinzu: „Hättest aber das Maul aufgemacht, wärst in Dachau gelandet.“ Und dann zur Bekräftigung sogleich hinterher: „Und ich sag’s nochmal, ob Dachau hin oder her, wer behauptet, dass er nicht gewusst hat, dass es den Juden an den Kragen geht, der lügt!“ Nach einem kurzen Moment des Innehaltens sagte er: „Und ich sag’s nochmal, die ganzen Zeitungen waren damals auch voll davon.“
Dann erinnerte er sich: „Ich weiß noch ganz genau, wie sie 1941 in Kesmark die Juden aus den Geschäften geprügelt haben und ihre Geschäfte und Schaufenster zerschlugen und sie dann in Viehwaggons Richtung Auschwitz schickten. Als das Fenster von dem jüdischen Bäcker zu Bruch ging, sind meine Kameraden und ich dann gleich hingelaufen und haben uns gierig an den Kuchen und Torten bedient. Jahre später habe ich mich dafür geschämt. Aber wir waren doch Kinder.“
Nach dem Krieg lange staatenlos
Als tschechoslowakischer Staatsbürger 1931 geboren, war mein Vater ab 1939 slowakischer Staatsbürger. Ab 1945 war er dann mit Ende des Zweiten Weltkriegs 12 Jahre lang staatenlos, bis er im Juni 1957 seine Einbürgerungsurkunde erhielt.


Kaum war er deutscher Staatsbürger, begann er auch, wann immer er konnte, in die Zips zu reisen. 1968 lernte er dort auf einer Hochzeit meine Mutter kennen. Nach dreijähriger Fernbeziehung gaben sich meine Eltern 1971 in Pudlein/Podolinec am 16. Oktober das Ja-Wort. Danach zog meine Mutter zu meinem Vater nach Deutschland.

Was ich daraus gelernt habe
Im Nachhinein würde ich meinen Vater noch so vieles fragen wollen, nicht nur was die Zeit vor, während und nach dem Krieg angeht. Ich kann ihn nicht mehr fragen. Und dennoch bin ich sehr froh, dass er mir doch wenigstens einiges von sich aus erzählt hat. Dieses wenige jedoch hat mich sehr und für immer geprägt – wie das, was mein Vater mich lehrte: Es ist sehr wichtig, wählen zu gehen, denn wir leben in einer Demokratie und darum darf man nicht nur wählen, sondern muss sogar wählen. Ein jeder Mensch, ob reich oder arm und unabhängig seines Standes, gleichgültig welcher Nation, Kultur oder Religion, hat seine Ehr‘ und dies ist auch stets zu respektieren. Ebenso, dass Geschichte enorm wichtig ist, denn aus ihr lernt man aus der Vergangenheit für die (hoffentlich bessere) Zukunft.
Irgendwann ist die Zeit der noch lebenden Zeitzeugen vorbei. Und dann sind „wir“ dran, die danach Geborenen, das Wissen über diese Zeit weiterzugeben. Wir müssen uns an unsere Ahnen erinnern, weil sie es verdient haben, dass man sich an sie erinnert. Aber auch gegen ein Vergessen und in erster Linie: für ein „NIE wieder!“ Dafür ist der Blick aber umso mehr, auch von beiden Seiten, auf Vergebung und Versöhnung zu richten.